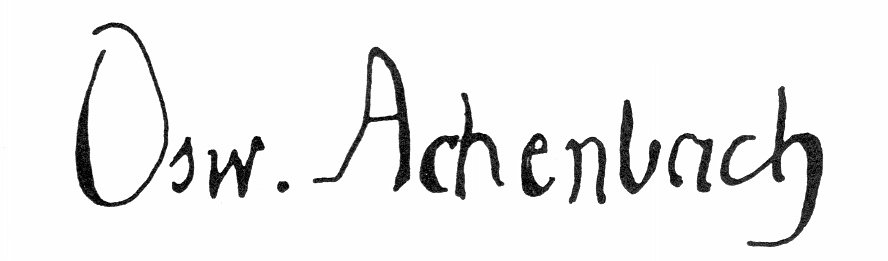Oswald Achenbach in Kunst und Leben
–
Von Caecilie Achenbach, Cöln 1912
Verlag der M. DuMont-Schauberg’schen Buchhandlung.
Druck von M. DuMont-Schauberg.

Vorwort
Diese Erinnerungen waren ursprünglich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Wenn ich sie ihr nun doch übergebe, so geschieht es, weil ich glaube, daß sie durch die eingefügten Urteile bedeutender Männer über die Kunst meines Vaters und seine Art zu lehren auch für weitere Kreise von Interesse sein dürften.
Düsseldorf, 27. Oktober 1912.
Caecilie Achenbach.
Inhaltsverzeichnis
Jugendzeit
Nach Italien! I Meine Mutter
Die ersten Schüler I Der Fürst von Hohenzollern
Sein Atelier I Wie Oswald Achenbach arbeitete
Vom Malen und von den Farben I Die Skizzenbücher
Umstimmen und Übermalen I Bildertitel.Kunsthändler und Mäzen
Kunstanschauungen I Lehrtätigkeit
Oswald Achenbach und die Musik I Das Haus in der Goltseinstraße
Oswald Achenbach als Mensch I Auf Reisen
Der siebzigste Geburtstag I Der Lebensabend
Schluß
Jugendzeit
Jugendzeit
Die Familie Achenbach stammt aus der Provinz Hessen-Nassau, aber ein Zweig verpflanzte sich nach der Sieg. Schon 1337 adelig, verzichteten die Achenbachs später auf den Adel und übertrugen den größten Teil ihrer Besitzungen auf einen Orden in Marburg.
Woher die Begabung der Brüder Andreas und Oswald für die Malerei stammt, wissen wir nicht. Ihr Vater nannte sich Kaufmann, war aber mehr Dichter und Schriftsteller. Ihr Großvater reiste ohne festen Beruf in der Welt herum und versuchte sich in Entdeckungen und Erfindungen. Die Mutter, Frau Christine, war eine geborene Zülch. Ihre Familie stammt aus Hessen-Cassel, war sehr begütert und merkwürdigerweise dem sonst so unbeliebten Kurfürsten Wilhelm IX. herzlich ergeben; Großmutter erzählte uns, daß ihr Vater zu der Zeit, als der Kurfürst vertrieben wurde, verschiedene von dessen Kunstschätzen angesteigert habe, die er demselben bei seiner Rückkehr wieder zustellte. Auf diese und ähnliche Züge hin, auch bei den Großeltern Achenbachscher Seite, ließe sich wohl die Großzügigkeit, welche Andreas und Oswald in allen Lebenslagen charakterisierte, und welche ihnen auch persönlich viele Freunde erwarb, zurückführen, wogegen, wie gesagt, nirgends eine Spur zu finden ist, die bewiese, daß ihre künstlerische Begabung ererbt.
Unsere Großeltern verlebten die ersten Jahre ihrer Ehe in Cassel, wo ihnen das erste Kind, Andreas, geboren wurde. Da aber Großvater Hermann sich nirgends lange wohlfühlte, beschloß er eines Tages, nach Düsseldorf überzusiedeln.
Hier erblickte mein Vater am 2. Februar 1827 das Licht der Welt, und zwar zu Pempelfort, in dem gleich neben dem Schlößchen Jägerhof gelegenen Hause Rönz, in einem Zimmer des ersten Stockes, merkwürdigerweise unter einem kolorierten Kupferstich, einen Ausbruch des Vesuv*) darstellend. „Wenn das kein Omen war!“ hat mein Vater oft lachend gesagt. Dieser Vesuv war ein sehr stark feuerspeiender Berg. Blutrot und golden schießen die Feuerwolken, Säulen und Flammen zum nächtlichen Himmel empor. Oswald hat den „alten Herrn“, wie er den Vesuv zu nennen pflegte, später allerdings anders aufgefaßt und wiedergegeben; eine Eruption von solch blendender Pracht hatte er wohl einzig und allein auf dem Farbstich, der über seiner Wiege hing, bewundern können.
*) Éruption du Mont Vésuve 1779. Gravé d’après le dessin original del Segnor Alexandre d’Anna, peintre du Roi de Naples. Der Stich ist im Besitz meiner Schwester, Frau von Borries.
Auf die Dauer vermochte aber auch Düsseldorf unseren Großvater nicht zu fesseln, und so führte er seine Familie nach München, überzeugt, diesmal das Richtige getroffen zu haben. Andreas blieb in Düsseldorf. An die schöne Isarstadt knüpften sich für Oswald die liebsten Jugenderinnerungen, dort erwachte seine Liebe zur Natur, dort fühlte er schon als Knabe, daß er ein Maler war.
Die großen Fußtouren ins bayerische Gebirge, über den St. Bernhard und den Gotthard, die er und sein Vater gemeinsam wie zwei gute Kameraden unternahmen, sind ihm unvergeßlich geblieben. Er behauptete, seinem Vater vieles zu verdanken. „Frohnatur und Hang zum Fabulieren habe ich auch nicht gestohlen,“ sagte er einmal lachend; „mein Vater war ein Dichter von Gottesgnaden.“ Daß der Dichter von Gottesgnaden nebenbei ein sehr schlechter Geschäftsmann war und sich über seine verfehlten Spekulationen nicht einmal sonderlich aufregte, erzählte er mir auch in einer schwachen Stunde.
Schade, daß Großvater Hermanns Schriften nicht für die Öffentlichkeit erschienen sind, seine Reisetagebücher über Amerika und Rußland sind sehr unterhaltend. Daß er den Thomas a Kempis in Hexameter setzte, schien uns Kindern eine Geschmacksverirrung, dagegen liebten wir seine Reiselieder. Als „Oswald“ (wie auch wir Kinder ihn gerne nannten) seinem Vater durch die Schule mehr und mehr entzogen wurde, verlor dieser allmählich die Freude an München und führte kurz entschlossen seine Familie nach Düsseldorf zurück. Mein Vater war noch ein Kind, als er dort zuerst die Akademie besuchte; der zwölf Jahre ältere Bruder führte ihn dort ein. Aber Oswald hielt nicht viel von akademischer Weisheit und dumpfen Schulsälen, um so mehr vom Studium in der freien Natur, wie er es unter seines Vaters Leitung gelernt. „Ganz zu umgehen war die Akademie ja nicht,“ – sagte er oft lachend, „obgleich ich es stets im weitesten Bogen versuchte; manchmal wurde ich doch eingefangen, und dann hieß es fürs erste: „Adieu Bilkerbusch und Grafenberg!“ Aber was ich daraus gelernt habe, das habe ich draußen gelernt. Alles, was ich kann, verdanke ich meinem Fleiße und der Natur!“ Einmal fragte ich ihn, ob seine Schüler sich auch so ablehnend gegen ihn verhalten hätten, wie er gegen seine Professoren seligen Andenkens? – „Ach was,“ sagte er, „das ist gar kein Vergleich. Die alten Herren an der Akademie hatten absolut kein Verständnis für uns „Junge“, meine Schüler waren meine Freunde, wir trieben alles gemeinsam: Malen, Kegeln, Singen, Theaterspielen. Mit dreiundzwanzig Jahren hatte ich meine ersten Schüler, und mit fünfundvierzig legte ich die Professur an der Akademie überhaupt schon nieder. Wir waren eben zusammen jung, meine Schüler und ich!“
Mit Hans Gude, Knaus, Des Coudres und Flamm hatte mein Vater ein Freundschaftsbündnis fürs Leben geschlossen. Im Jahre 1848 verlobte er sich mit Julie Arnz, der Tochter des Düsseldorfer Verlagsbuchhändlers Heinrich Arnz, der ein großes Haus, ein ehemaliges Beguinenkloster in der Ratingerstraße, bewohnte, wo Maler und Musiker, Schriftsteller und Buchhändler vielfach verkehrten. Dieser in stürmischer Zeit geschlossenen Verlobung folgte die glücklichste Ehe, die nur der Tod getrennt hat.
Nach Italien! I Meine Mutter
Nach Italien!
In das Revolutionsjahr fällt auch die Gründung des Malkasten. Oswald, Gude, Flamm, Knaus und Des Coudres waren natürlich unter den Gründern. Und dann begann die schöne Zeit der ersten größeren Studienreisen. Während Knaus mit den viel älteren Freunden Fay und Salentin in den Schwarzwald zog, fuhr Oswald ins bayerische Gebirge, das ihm von seiner Kindheit her ans Herz gewachsen war, und nach Tirol, später gemeinsam mit Flamm und andere Freunden nach Oberitalien, Rom und Neapel. Quartette singend waren die Freunde in der offenen Postchaise über den Gotthard gefahren. Quartette singend fuhren sie in Venedig durch die Lagunen und Kanäle und ernteten reichen Beifall. Sie verursachten sogar auf dem Marcusplatz einen begeisterten Volksauflauf. Als sie aber nach Florenz kamen, war ihnen die laute Lust vergangen. Zum erstenmal standen sie staunend all den Herrlichkeiten gegenüber. Mein Vater sagte: „Die Kunstschätze hatten uns überwältigt, fürs erste war’s zu viel, und wir zogen wieder hinaus und ließen alles in uns nachtönen.“ Oft erzählte er mir von dem herrlichen Ausblick, den er auf dem schmalen Bergrücken hinter Camaldoli immer und immer wieder suchte. Auch die berühmte Abtei war ihm ans Herz gewachsen. Die frommen Brüder waren die besten Freunde der Maler und Oswalds liebste Staffage; er konnte ihre Vertreibung aus den Bergklöstern auch nicht verschmerzen und meinte, nun hieße es überhaupt: „Gute Nacht, Poesie und Romantik!“ Am liebsten hätte er sein Quartier bei ihnen aufgeschlagen, denn die kleinen Osterien in den Bergnestern waren meist nur Spelunken und wimmelten von verdächtigem Gesindel. Einmal hatten sie mit einem höchst unsicheren Kumpan nicht nur dasselbe Zimmer, sondern auch dasselbe Bett teilen müssen, bis berittene Karabinieri ihn aus ihrer Mitte arretiert und abgeführt hatten.
In Rom sahen sie Garibaldi und schlossen sich den tollten Ovationen an, die besonders die Amerikaner und Engländerinnen dem Freiheitshelden brachten. „Ein enthusiastischer Amerikaner“, erzählte Oswald, „war uns aber über; er stieg auf eine Leiter, die er an das im ersten Stockwerk liegende Fenster Garibaldis gelegt, und besah ihn sich auf diese Weise, denn unser Held war krank oder ovationsmüde, jedenfalls ließ er niemand zu sich hinein.“
„Interessanter wie Garibaldi war mir Pionono. Für mich war er in Poesie und Romantik gehüllt. Ich hatte auch das Glück, einmal von ihm gesegnet zu werden, und das kam so: Mit Schirm und Malkasten beladen, kam ich am Abend eines schweren Arbeitstages von draußen aus der Campagna. Es fing schon an zu dämmern, der ganze weite Petersplatz war einsam, da sah ich die päpstliche Equipage heranrollen. Schleunigst kniete ich nieder; Pionono beugte sich vor, lächelte mich an und segnete mich!“ – Mein Vater hat dieses Lächeln nie vergessen, und Pius dem Neunten hat er stets eine besondere Zuneigung bewahrt. Verschiedentlich hat er ihn gemalt, und ein ganz großes „Piononobild“ stand in seinem Atelier, als er starb.
Erzählte mein Vater von seiner ersten Ankunft in Neapel, so begeisterte er sich immer aufs neue. „Nie“, sagte er, „vergesse ich den Eindruck, den ich empfing, als ich zum ersten Male im Hafen von Neapel landete! Kein späteres Bild hat die Erinnerung an diese überwältigende Herrlichkeit erreichen können. Der Himmel, der Strand, das Meer, der Vesuv hatten eine Färbung, die ich nirgendwo anders gesehen. Dieser Eindruck war entscheidend für mein Leben und für meine Kunst!“
Meine Mutter
Am 3. Mai 1851 hatten sich meine Eltern verheiratet, und von nun an wurden alle Reisen gemeinsam unternommen. Nur im Frühjahr 1857 ging’s noch einmal allein mit seinen Schülern und Freunden Jobst Meyer im Grunde (benannt „der Schweizer Meyer“), dem Amerikaner Irving und seinem Schwager Arnz nach Florenz, Rom und Neapel. Meine Mutter war eine geistig bedeutende Frau, heiter und witzig, und meine Eltern genossen das gemeinsame Reisen sehr. Als ich meinen Vater einmal fragte, wie seine Julie wohl damals ausgesehen habe, da sagte er mir: „Da hättest du Heß fragen müssen, der sagte, was später auch der gute Prokesch meinte: „Solche Augen, solche Gestalt und Haltung gibt es nicht wieder! Sie war hübsch, ohne regelmäßige Züge zu haben, – – für mich war sie immer die Schönste!“ Leider besitzen wir kein Porträt meiner Mutter, nur zwei allerdings sehr schöne Handzeichnungen von Max Heß und von Knaus.
Die ersten Schüler I
Der Fürst von Hohenzollern
Die ersten Schüler
Bis zum Jahre 1864 bewohnten meine Eltern eine hübsche Wohnung, Ecke Schadow- und Viktoriastraße, mit Gartenhaus, worin die Ateliers der Schüler lagen; denn schon Anfang der fünfziger Jahre hatte mein Vater eine ganze Anzahl Schüler. Die meisten waren gleichalterig, manche auch älter als er, aber: „all miteinander jung!“ wie Oswald zu sagen pflegte. Ich lernte in späteren Jahren verschiedene dieser ersten Schüler kennen, die sich eine Freude daraus machten, mir aus jener „herrlichen Zeit“ zu erzählen. Einer sagte mir: „Es war wirklich die höchste Zeit, daß Ihr Vater zum ordentlichen Professor an der Akademie ernannt wurde, und daß wir nun die Schülerateliers dort beziehen mußten. Auf die Dauer hätte Ihre Mutter das gar nicht ausgehalten. Wir dachten nämlich, Ihre Eltern seien vom lieben Gott eigens dazu geschaffen, uns alle Mühen und Unbequemlichkeiten des täglichen Lebens abzunehmen. Jeden Augenblick stürmten wir ungeniert ins Vorderhaus, brachten Oswald, wenn er nicht zur erwarteten Stunde bei uns zur Korrektur erschien, das nasse Bild ins Atelier oder präsentierten uns Ihrer Mutter im eben angekommenen Maskenkostüm, das nicht recht sitzen wollte oder nicht echt genug schien. Wir malten ja nicht nur mit Ihrem Vater, wir sangen und mimten unter seiner Leitung. Aber oft sagten wir uns, das muß nun aufhören, und schämten uns, daß wir Ihre Eltern bei jeder Gelegenheit in Mitleidenschaft zogen; aber trotz der besten Vorsätze – – im gegebenen Moment war es doch immer wieder dieselbe Geschichte.“
Meine Eltern haben den Schülern „aus dem Vogelhaus“, wie der Atelierbau genannt wurde, die herzlichste Erinnerung bewahrt. Dadurch, daß mein Vater sich ein eignes Haus baute, war der „Schülerwirtschaft“, wie mißvergnügte Nobili das nannten, ohnehin eine Grenze gesteckt.
Aber auch nachdem die Schüler die Ateliers in der Akademie bezogen hatten, und meine Eltern längst das selbst erbaute Haus bewohnten, wußten sie Oswald zu finden, holten ihn zu allen Zeiten oder brachten ihm wie früher ihre großen Bilder und kleinen Sorgen zur Goltsteinstraße. Und meinem Vater war es stets die größte Freude, ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
Der Fürst von Hohenzollern
Damals lebte in Düsseldorf der Fürst Carl Anton von Hohenzollern-Sigmaringen; er bewohnte mit seiner Familie das Schlößchen Jägerhof, und er hatte einen Hof um sich geschaffen, an den er die Künstler mit Vorliebe zog. Meinem Vater war er besonders gewogen, und er verbrachte manche Stunde im Atelier. Aber auch für seine Lehrtätigkeit an der Akademie hatte der Fürst ein lebhaftes Interesse. Das ging ja damals alles Hand in Hand, und die jungen Elemente, die unter Oswalds Leitung sangen und mimten, standen seinem Herzen ebenso nahe wie die, welche malten, und er verstand es meisterhaft, das Interesse des Fürsten den jungen, strebsamen Künstlern zuzuwenden. Fürst Carl Anton war eine in allen Ateliers mit Freuden begrüßte Persönlichkeit; er war eben nicht nur ein vornehmer und liebenswürdiger, sondern auch ein kluger und witziger Herr. Mit Vergnügen erzählte mein Vater stets folgende kleine Geschichte, die so recht charakteristisch für den Fürsten ist:
„Fürst Carl Anton kam eines Morgens mit der Bitte zu mir ins Atelier, ihm beim Umtausch eines Bildes, das er vor einiger Zeit bei Schulte gekauft, behilflich zu sein. Es gefalle ihm nicht mehr so recht. Das Bild war vom Maler Rausch, einem Mitgründer des Malkastens. „Aber warum haben Königliche Hoheit es denn gekauft?“ fragte ich ihn. – „Ja,“ meinte er, „es hatte mir zuerst so gut gefallen.“ Ich nahm an, daß jemand ihm den Rausch verleidet habe. Der Fürst, feinfühlig wie immer, merkte, daß mir die Sache unangenehm war, und sagte lachend: „Seien Sie ruhig, Professor, ich behalte den Rausch! Denn:
„Wer niemals einen Rausch gehabt, der ist kein braver Mann!“ –
Sein Atelier I
Wie Oswald Achenbach arbeitete
Sein Atelier
Oswalds Werkstatt hatte wenig Ähnlichkeit mit dem landesüblichen Atelier; sie wirkte eher als Festraum und war auch als solcher gedacht. Schön gerahmte Bilder hingen an den Wänden, auf dem tadellos glänzenden Parkett lagen kostbare Teppiche und ein heiteres Deckenmedaillon hatte mein Vater s. Z. selbst bemalt. Besondere Freude machten ihm seine schönen antiken Schränke. Auf seinem runden, eingelegten Florentiner Marmortisch sah er gerne Blumensträuße, besonders frische Rosen. Ein zweites Atelier mit großem Oberlicht lag im dritten Stock. Das untere Atelier hatte reines Nordlicht, drauf hielt mein Vater sehr, obgleich er auf Reisen anstandslos in sonnendurchleuchteten Stuben gemalt hat.
„An meinem Atelier ist gar nichts zu sehen,“ – pflegte er seinen Besuchern wohl zu sagen, „nur hier mein Balkonfenster und mein Balkon mit dem schönen Blick in die Hofgarten-Anlagen sind sehenswert.“ Das Balkonfenster und der Balkon hatten allerdings die größte Anziehungskraft für meinen Vater. Besonders im Sommer trat er mit der Palette in der Hand jeden Augenblick hinaus, kontrollierte Wolken und Hofgarten und ließ sich von den von der Heide heimkehrenden Regimentern ein Lieblingsstück blasen.
Es gibt wohl kein Atelier, in dem so viel geputzt, gebohnt und aufgeräumt wurde, als in dem meines Vaters. Manchmal brummte er auch, aber das Putzen geschah nur zu Zeiten, wo es ihn nicht stören konnte, und schließlich freute er sich doch, wenn alles schön an seiner Stelle lag und die herausgeholten Skizzen und Zeichnungen wieder unter Verschluß waren.
In Oswalds Atelier ging’s stets aus und ein, vom jüngsten Leutnant bis zum höchsten Potentaten kamen ihm alle recht, nur durften nicht gerade Kopf, Herz und Hände zu tief in einer Untermalung stecken. Lernte er jemand kennen, der ihm gefiel, so sagte er ihm: „Besuchen Sie mich doch!“ Aus solchen Atelierbesuchen entspann sich manchmal eine Freundschaft fürs Leben.
Unsere Freunde kannten jedes Bild, jede Aufzeichnung, und dem Entstehen der Bilder zuzusehen, war die größte Freude aller. Mein Vater ließ sich beim Malen gar nicht stören; kam ein neuer Gast, so streckte er ihm den reinsten Finger entgegen oder auch nur den Ellbogen, denn seine Hände waren gewöhnlich ganz unter Farbe.
Ging man nachmittags nach dem Tee noch einmal ins Atelier, dann war Oswald bei sich selbst zu Gast und besah sich mit den Freunden gemeinsam die Bilder. Dann mußte Johann die großen Untermalungen, die einen eigenen Raum für sich im zweiten Stockwerk des Anbaues inne hatten, hinauf und herunter schleppen. Die Untermalungen waren die allgemeinen Lieblinge; sie waren so amüsant, weil sie alle so verschieden waren. Einige ganz hell, Luft und Meer wie weißes Silber, andere mit roter Luft und grünem Meer oder grau-rosa Wolken und violettem Meer, dann die pechrabenschwarzen Nachtbilder mit Feuerschein. Diese Untermalungen waren alles ganz große schwere Bilder; Johann wußte ein Lied davon zu singen.
Einmal bat die liebenswürdige Prinzeß Heinrich XIII. Reuß, ihr doch etwas vorzumalen. Oswald, nicht faul, nahm eine Spachtel voll Schweinfurter Grün und „strich“ einer italienischen Obstverkäuferin, die auf ihrem mit Körben beladenen Esel thronte, eine grellgrüne Jacke. Allgemeine Verblüffung, besonders bei meiner Mutter, für welche die grünen Jacken der Italienerinnen das „rote Tuch“ waren.
Auch die Skizzenbücher fanden viele Freunde, jeder nahm sie sich und blätterte darin. Nur die großen Mappen mit den Zeichnungen aus den Jahren 50, 57 und 70 blieben stets unter Schloß und Riegel. Die Zeichenbücher (Skizzenbücher) waren sehr amüsant, es stand auch viel geschrieben darin, und das erregte stets Neugierde und Heiterkeit.
Es war sehr schwer, meinen Vater aus dem Atelier zu locken. Eben unten, war er wieder oben. Er ging auch nie schlafen, ohne vorher noch einmal im Atelier gewesen zu sein, und nie kam er zum Frühstück, ehe er sein Bild begrüßt und geprüft hatte.
Wie Oswald Achenbach arbeitete
Stellte mein Vater eine frische Leinwand auf die Staffelei, so war dies sein bester Tag. Den Entwurf zu dem Bilde hatte er fertig im Kopf, und dieses entstand in allerkürzester Zeit in seiner ganzen Form und Farbenwirkung. Ich habe bei andern Künstlern gesehen, daß in ihrem Atelier das große Bild mit Kohle oder auch Bleistift aufgezeichnet war, daneben stand die ausgeführte Skizze, und das Bild wurde genau nach der Skizze stückweise fertiggemacht. So arbeitete mein Vater nicht. Er machte wohl auch mal eine Skizze zu einem Bilde, aber er benutzte sie dann doch nicht. Wenn dann meine Mutter fragte, warum er die Skizze nicht benutze, sie sei doch so schön gewesen, da hieß es „Ach was! Das würde mich schrecklich langweilen, auf einem großen Bilde wirkt das alles auch ganz anders wie auf einem kleinen.“
Diese großen Entwürfe machten ihm die größte Freude. Mit Spachtel, Daumen, manchmal mit der ganzen Hand ging es in den Farben herum, und am Abend eines solchen Tages war er, sein Bart und besonders sein Malrock nur wenig von der Palette und der neuen Untermalung (denn das war nun eine Untermalung) zu unterscheiden. Ich wollte eines Tages mit Freunden über Land fahren. Als ich ins Atelier kam, sah ich, daß mein Vater eine frische Leinwand aufstellte. Da fragte ich ihn, was er denn auf der Palette habe. „Glanzschuhlack,“ sagte er lachend, „ich will die pontinischen Sümpfe im Mondschein malen.“ Dann erklärte er mir, wie er sich das Bild gedacht: Mondschein. Auf der Landstraße rollt ein von berittenen Karabinieri begleiteter Reisewagen dem Beschauer entgegen. Der Schein der Wagenlaterne ist durch den Dunst, den die Sümpfe ausströmen, unheimlich vergrößert. Links von der Landstraße rotbrauner Qualm und eine Anzahl Büffel. Dann explizierte er mir, daß diese Feuer zum Austrocknen dieses schlimmsten Malariaherdes dienen, und daß sich nächtlicherweile alle Büffel der Nachbarschaft, durch die Feuer angelockt, dort Rendezvous gäben, – und gleich war er auch schon bei der Arbeit.
Als ich abends heimkehrte und gewohnheitsmäßig zuerst ins Atelier ging, war ich starr. Da lagen sie vor mir, die Pontinischen Sümpfe, da waren die Büffel, die nächtlichen Feuer, der Reisewagen, die Karabinieri und die Laternen, – weit hinten am Horizont leuchtete silbern im Vollmondschein ein schmaler Meeresstreifen. Wenn das keine Hexerei war!
Oswald lachte über mein verblüfftes Gesicht. Ich ging ganz dicht an das Bild heran, – und da war natürlich das obligate Untermalungsdurcheinander, durch Laternen und Feuer war man zwar orientiert, das die Ochsen und wo der Reisewagen. Bei andern Untermalungen ist es mir oft vorgekommen, daß ich all die interessanten Sachen, die ich von weitem gesehen, in der Nähe überhaupt nicht wiederfand, bis ich zurücktrat und alles wieder da war. Baron Türke (Dresden), ein Schüler meines Vaters aus den sechziger Jahren, schrieb über diese Art Hexerei: „Sah ich doch einmal, wie er mit dem Pinsel in ein paar Haufen Farbe fuhr, dann den Pinsel einmal auf die Leinwand setzte, und da stand auch schon, von einiger Entfernung aus gesehen, ein Kerl, der Rock und Beinkleider anhatte!“ – –
Über meines Vaters eigenartige Maltechnik schrieb mir sein langjähriger Freund, der geistvolle Kunstkenner und Sammler, Landschaftsmaler Professor Georges Oeder in Düsseldorf:
„Was mich persönlich betrifft, so schätzte ich stets seine Kunst so hoch, weil sie ganz und gar eigenartig war, niemand vor ihm eine ähnliche, leichte, geistvolle Technik in der Landschaftsmalerei angewandt hat. Er stand in dieser Beziehung ganz einzig da, während fast alle übrigen Kollegen, sein Bruder Andreas nicht ausgenommen, sich mehr oder weniger an ältere Vorbilder, wie z. B. die Düsseldorfer, hauptsächlich an die alten Niederländer anlehnten.
Bei Oswald hat zu dem Charakteristischen seiner Malweise meines Erachtens kaum ein Vorgänger ihm den Weg gewiesen.
Wie lebendig und sprudelnd ist diese Technik, mit wie wenigem erzielt er die reichsten Effekte, sei es im grellsten Sonnenlicht, sei es in Abenddämmerung und Mondschein, wo, ohne deutlich zu sehen, die Phantasie des Beschauers alles mögliche tut und die Ideen des Künstlers weiter zu spinnen vermag.
Es ist in diesen Bildern nicht nur ein Moment wiedergegeben, sondern man meint, im Bilde weiter mitleben zu können, vom Morgen zum Abend, vom Abend zum Morgen. Darin liegt wohl der Hauptreiz, den die Oswald Achenbachsche Kunst auf das Publikum ausübt. Vieles wird ja die moderne Anschauung an dieser Kunst auszusetzen haben und manches sogar streng verurteilen. Dieses wird aber dem späteren Andenken des Meisters keinen Schaden tun, und die Kunstgeschichte wird in Zukunft den Namen Oswald Achenbach in goldenen Lettern stets festhalten. – – –„
Manchmal wandelte Oswald die Lust an, Landschaften mit ganz großen Figuren zu malen, aber ein Ein- und Ausgehen von Modellen war in seinem Atelier ausgeschlossen, und da er ja immer nur malen wollte, was und wie er es wirklich gesehen, und darum ohne Modell nicht hätte auskommen können, verzichtete er auf die Erfüllung dieses Wunsches. Früher mußte meine Mutter, später wir Töchter ihm oft Modell stehen. Es war erstaunlich, wie schnell er zeichnete und dabei so ähnlich, daß auch auf den Bildern die Freunde uns gleich herausfanden. Er brachte uns in allen Situationen, am liebsten auf einem galoppierenden Esel. Baron Prokesch-Osten schrieb seinerzeit meinem Vater: „Ich glaube, in der Karawane, die unten über die grüne Matte zum Klösterli zieht, Ihre liebe Frau zu erkennen, bilde es mir wenigstens ein, was mir das Bild nur um so lieber macht – – –.“ Mich malte er einmal in meiner besten Sommertoilette am Arm eines gemeinen Matrosen, am Strand von Santa Lucia bummelnd. Ich hatte ihm vor meiner Abreise dazu „gestanden“, nicht ahnend, in welche Gesellschaft er mich bringen würde. Da das Bild noch während meiner Abwesenheit bei Schulte ausgestellt wurde, bekam ich von verschiedenen Seiten darauf hinweisende Postkarten. Freunde, die aus Italien kommen, bedauern stets, daß mein Vater das Selbstporträt für die Uffizi-Galerie nicht machen wollte; bei seiner Virtuosität für alles, was Zeichnen und Staffage anbelangt, würde es ihm sicher gut gelungen sein. So fehlt sein Bild dort, – denn es sollen eben Selbstporträts sein.
Vom Malen und von den Farben I Die Skizzenbücher
Vom Malen und von den Farben.
Von der Palette und von den Pinseln.
Das Malen war Oswalds größte Freude, besonders wenn es so recht aus dem Vollen ging und die Farbe buchstäblich Schatten warf! Wenn meine Mutter vorsichtig ragte, wieviel Pfund Farbe wohl auf solch einem Bilde sei, meinte er lachend: „Schönfeld will doch auch leben.“
Hatte er nicht gar zu große Sehnsucht nach den Untermalungen, die daheim im Atelier standen, so malte er auch auf unsern Reisen gerne, und es entstanden kleine, flüchtige Plagiate seiner eigenen großen Bilder. Dann „verarbeitete“ er alle Verpflichtungen an Vielliebchen, Lotterie- und Basarversprechungen. In Kissingen im grellblauen, sonnendurchleuchteten Salon und auch in Marienbad und Carlsbad lagen an regnerischen oder besonders heißen Tagen dickbemalte Pappdeckel und Brettchen auf Tischen, Stühle und Etageren, unsere und unsrer Besucher Kleider wußten ein Lied davon zu singen und nahmen auch sehr zum Schaden der Skizzchen manch dick aufgesetzten Mond- und Sonnenschein mit sich fort.
Ein ähnliches Schicksal hatte seinerzeit auch ein kleines Lichtchen auf einem Bild „Der heilige Januarius“ auf der Ponte della Maddelena in Neapel. Eines der leuchtenden Laterncen, die dem Heiligen zu Ehren neben der stets mit Blumen geschmückten Statue brennen, war zum Kummer des Besitzers ausgegangen, und mein Vater wurde gebeten, es wieder anzuzünden. In dem Laternchen hatte nämlich eine Unze oder noch mehr gelber Farbe gesessen, daher rührte die Leuchtkraft: „Aha,“ sagte Oswald, als er von der Sache hörte, „das kenne ich schon. Herr Soundso hat gewiß mit dem Nagel an das Lichtchen gefühlt.“ Er hat aber das Laternchen schnell wieder angesteckt, nachdem es zu dem Zweck ins Atelier gebracht wurde.
Mondschein, im Verein mit Kerzenbeleuchtung, wie auf dem Bilde des heiligen Januarius, liebte Oswald sehr zu malen. Besonders aber freuten ihn die drei Lichtbilder: Der Mond, der meist schon einen leichten Schein hatte, während die untergegangene Sonne noch Purpurstreifen über den Horizont zog, dazu überall brennende Laternen, erleuchtete Fenster, Raketen, bengalische Beleuchtung und Feuerwerk; je reicher der Zusammenklang der Farben wurde, desto mehr freute es ihn.
An solchen Abenden sah die Palette oft eigenartig aus. Aber ich habe immer beobachtet, daß gerade aus den sonderbarsten Paletten die schönsten Bilder hervorgingen.
Über Oswalds Verhältnis zu den Farben schrieb mir seinerzeit Baron Karl von Perfall (Köln):
„Über seine Kunst habe ich mich wiederholt dahin geäußert, daß Meister Oswald schon vor der Erscheinung des französischen Impressionismus in seiner Farbengebung dessen Ergebnisse ohne Theorie vorweggenommen hat. Ich meine den Zusammenklang kleinster Tonmannigfaltigkeiten zu der großen Harmonie, die Technik im Sinne von Handschrift ist dabei gleichgültig, ohne Stricheln und Punktieren hat er rechte Impressionen des Lichtes und seiner Wirkungen gegeben.“
Große Freude machte meinem Vater das Malen der Farbstudien. Aber gerade beim Ölmalen draußen im Freien empfand er schmerzlich die Unzulänglichkeit des Malmaterials. Das sei alles Stückwerk, sagte er dann, wenn er nur wenigstens die Sonne und den Duft malen könnte, es müßten neue Farben erfunden werden, denn er könne unmöglich mit seinem Malkasten auskommen.
Zu entmutigen war er aber nicht. Er versuchte nun die Farben, sie sie in der Sonne aussahen, auch im Schatten herzustellen. Dann wanderten wir in die Läden und suchten nach roten, gelben, violetten und tiefgrünen Stoffen, von diesen klebte er kleine Stücke wie leuchtende Klexe in die Skizze hinein, bis er die gewünschte Wirkung gefunden hatte. Dann stellte er sich aus seinem Farbkasten die Farben zusammen, die den Effekt hervorbrachten, den er draußen in der Natur so sehr bewundert hatte. Es ist wenig Positives auf diesen Blättchen, Papier und Klexe, aber die Farbstimmung ist gelöst, und tritt man zurück, so erscheinen sie wie ein fertiges Bild. Als ich meinen Vater einmal fragte, warum er diese bunten Fetzen in seine Skizze klebe, sagte er: „Ich werde mir doch nicht meine ganze Skizze verschmieren, indem ich in das Nasse hineinmale. Auf diese Weise kann ich in größter Geschwindigkeit, ohne Farbe und Pinsel, eine Menge verschiedener Effekte versuchen. Wollte ich Öl über Öl malen, so würde ich jedesmal das vorherige wieder zerstören. Und wenn ich es noch so sorgfältig wegwische, ein ganz reiner Farbton käme doch nicht heraus, – das ist wie bei der üblen Nachrede, da bleibt auch immer etwas hängen, – außerdem bedeutet mein Lappensystem eine große Zeitersparnis.“
Eine Staatsaktion war das abendliche Absetzen der Palette. Oswald behauptete dann, er präpariere sich schon aus den Farbresten, die schön im Kreis auf eine frische Palette gesetzt wurden: „Regenbogen, Gewitterwolken, faule Fische und dergleichen für das morgige Bild.“ Niemand durfte an die Palette rühren. Es war ein Ausnahmefall, wenn Johann das Absetzen vorhergegangener, peinlicher Explikation übernehmen durfte. Nachdem er ihm aber einmal einen präparierten „Sonnenuntergang“ so gründlich verdorben, daß er nur noch zu einer Schiffsladung Orangen taugte, vertraute er ihm dieses Ehrenamt auch nicht mehr an.
Auf seine Pinsel legte mein Vater weniger Wert, er sprach selten von ihnen, und ihr abendliches Reinigen war Johann auf Gnade und Ungnade überlassen.
Sein geringeres Interesse für die Pinsel kam wohl daher, daß er sie im Notfall entbehren konnte, malte er doch am liebsten mit Spachtel und Daumen.
Die Skizzenbücher
Dass Oswald lieber malte als zeichnete, hat er stets lachend zugegeben. Trotzdem besitzen wir eine große Anzahl Skizzenbücher und viele, viele Zeichenmappen, besonders aus den Jahren 1845, 48, 50 und 57. Wie sauer mag es ihm wohl oft geworden sein, den ganzen Morgen zu zeichnen, wenn die Sonne und all die Herrlichkeit lockte und er seinen Farbkasten neben sich hatte. Manche von den großen Zeichnungen aus jener Zeit, zu denen er sehr großkörniges Papier verwandte, haben denn auch etwas von dem so nahen Farbkasten abbekommen. Himmel, Wölkchen, Mühlbachstaub sind verschiedentlich ganz leicht blau und weiß angetönt; auf Tannen, Matten, Schweizerhäuschen ist mit grüner und brauner Farbe breit und begeistert hingestrichen worden.
Als wir diese Zeichnungen eines Tages durchsahen, konnte ich nicht umhin, zu bemerken: „Aha, da haben wir ja die richtigen Vorläufer deiner großen Untermalungen.“ Und mein Vater sagte: „Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen.“ Für Oswald ging eben die größte Anziehungskraft vom Farbkasten aus. Er meinte, der schönsten Zeichnung fehle, was ihn am meisten freue, das Volle, das Gesättigte; Jauchzen und Schluchzen könne er sich nur in Tönen oder in Farben denken, – Zeichnen sei ihm immer nur Mittel zum Zweck gewesen; aber trotzdem sei die gründliche Erlernung des Zeichnens unerläßlich für jeden Maler.
Er hat übrigens auch in früheren Jahren lithographiert. Zwölf Originallithographien (1850–58) sind im Besitz eines Düsseldorfer Sammlers.
Schriftliches enthalten Oswalds Skizzenbücher zu allen Zeiten. Angabe der Farbe, Stand der Sonne und auch andere Hinweise wie: „die Disteln der Villa G. nicht vergessen.“ In einem Skizzenbuch von 1857 steht neben einem fein gezeichneten Erntewagen mit Ochsen: „Sonne von oben, Ochsen weiß, violett im Schatten.“ An einer Stelle steht die ausführliche Beschreibung des malerischen Kostüms, das er in dem kleinen Wallfahrtsort Genazzano im Sabinergebirge bewundert hatte. In einem andern Skizzenbuch fand ich folgende Notiz: „Junge Frau in majestätischer Haltung wie eine Königin über Schweinen thronend.“ (Palestrina.) –
Oswalds Humor verleugnete sich eben nie; und da er keine Zeit gefunden, die imposante Signora an Ort und Stelle zu zeichnen, wollte er sie wenigstens aus der Erinnerung auf sein Bild malen, dazu genügte ihm diese Notiz.
Die Skizzenbücher aus de späteren Jahren waren eigentlich nur Notizbücher und bestanden hauptsächlich aus Kreuzchen und Anmerkungen, hier und dort markierte eine Dunkelheit Häuser, Bäume und Staffage. Die Zeichnungen waren bei unsern gemeinsamen Reisen entstanden, mein Vater ließ meine Mutter und mich nicht gerne so lange warten, drum waren sie mehr geschrieben wie gezeichnet; fragten wir dann schuldbewußt: „Genügt das dann?“ antwortete er vergnügt: „Das hab’ ich alles im Kopf!“
Umstimmen und Übermalen I
Bildertitel.Kunsthändler und Mäzen
Umstimmen und Übermalen
Stand eine Untermalung im Atelier, so hatte Oswald für nichts anderes Interesse, ob er nun versprochen hatte, ein Bild abzuliefern oder nicht. Dann horchte er wohl nach der Treppe; glaubte er Herrn Schulte zu hören, so stellte er schnell und höchst eigenhändig das ihm zugesagte Bild auf die Staffelei. Die Herren Schulte kannten ihn und hatten Nachsicht; meine Mutter aber nahm die Sache tragisch und behauptete, wenn das so weiter ginge, würden wir alle Hungers sterben. Da versprach ich ihr, ein deutsches Wort mit Oswald zu reden. Es war in Genua, an einem wunderbaren Herbsttage, wir hatten ein Auswandererschiff abfahren sehen und bummelten am Strande. Mein Vater war sehr vergnügt, rauchte und pfiff abwechselnd. Da sagte ich ihm, meine Mutter mache sich Sorgen, daß er sich so ausschließlich den großen Untermalungen widme, er würde das Ausführen dieser großen Bilder gar nicht bewältigen können; auch würden wir, glaubte sie, demnächst alle verhungern, denn Bilder von solchen Dimensionen kaufe kein Mensch. Meiner Mutter Sorge, er würde das Ausmalen der großen Bilder nicht bewältigen können, war das einzige, was ihn an der Sache zu interessieren schien. Nie vergesse ich sein verschmitztes Gesicht, als er mir erklärte: „Ausführen? – Die großen Bilder will ich gar nicht ausführen, die sind fertig; die müssen so sein. Wer ein Bild haben will, an das er so nahe herangehen kann, daß er die Farbe riecht, der muß nicht zu mir kommen.“
Seine Ansicht über das besonders Schöne der weniger ausgemalten Bilder suchte er zu allen Zeiten seinen Kunsthändlern beizubringen. Ich fand eine sehr spassige Korrespondenz zwischen ihm und den Herren van Pappeldamm & Schouten in Amsterdam woraus hervorgeht, daß er nur einen negativen Erfolg zu verzeichnen hatte, und daß sich die Herren nun ihrerseits bemühten, ihn auf den Pfad der Pflicht zurückzuführen. Nun ging das Streiten mit den Kunsthändlern los: sie müßten ihr Publikum bilden, erklärte ihnen Oswald empört, die Leute müßten doch etwas zulernen und nicht gar so naiv sein, oder Gott weiß wo ihre Bilder kaufen. Aber das kauflustige Publikum dünkte sich klug genug, wenn es für sein gutes Geld Mädchen ohne Augen, Nasen und Mäulchen ablehnte.
Mit Oswalds Leidenschaft für die großen Untermalungen ging Hand in Hand der Reiz, fertige Bilder „umzustimmen“ oder zu übermalen. War Oswald in „Umstimmung“, so verriet sich das bald, und meine Mutter benutzte jeden Vorwand, ihn an solchen Tagen aus dem Atelier zu locken; dabei leistete ich oft Hilfe, aber Erfolg hatten wir selten.
Einmal mußten wir den ganzen Tag unterwegs sein. Meine Mutter hatte das Programm für den Tag schon abends vorher gemacht, da mein Vater bei Tisch etwas von Pinien erzählt hatte, die sich doch vielleicht in der Ecke links des ganz hellen „Golf von Neapel“ gut ausnehmen würden. Mit dem Wetter hatten wir Glück, und mein Vater war, wie immer, wenn etwas unternommen wurde, in bester Laune. Als wir aber spät abends heimkamen und uns zu Tisch setzten, war er strahlend, er hatte es fertig gebracht, in weniger als einer Minute mit der Spachtel und etwas Umbra zwei große schlanke Pinienstämme über das silberige Meer bis in den Himmel zu streichen. Meine Mutter und ich mußten uns begnügen, einen verständnisvollen Blick zu wechseln. Gern hätten wir hellauf gelacht, denn die Landpartie mit Staub, Hitze und verbrannten Pfannkuchen war wieder einmal eine glänzend verlorene diplomatische Schlacht.
Rationeller als ändern und umstimmen war natürlich das Übermalen, ein Schicksal, das besonders oft die fertigen mittelgroßen Bilder traf. Mein Vater hatte die Eigentümlichkeit, Bilder, die der Kunsthändler nicht gleich verkaufte, zurückzunehmen und ihm andere dafür zu geben. Da er seine Mondscheine am liebsten über fertige Bilder malte, so waren diese zurückgenommenen Bilder fortwährend in Gefahr. Meine Mutter sorgte dann wenigstens, daß sie im Anbau, dem sogenannten Bilder-Exil, so hoch hingen, daß er sie nicht ohne Hilfe erreichen konnte. Es kam ihm übrigens gar nicht darauf an, Freunde und Bekannte um Bilderbeiträge zu bitten, sobald sein eigener Vorrat versagte. Graf Fritz Hochberg-Halbau erzählte mir über eine solche Zumutung: „Ihr Vater bat mich einst, mit einem ganz ernst liebenswürdigen Gesicht, ihm doch ein paar Skizzen oder ein Bild von mir zu geben. Ich zeichnete damals bei Albert Baur mit Kohle und dachte mir, als Ihr Vater mich um ein Bild bat, er verwechselte mich mit jemand anderm, denn warum sollte er ein Bild von mir haben wollen? Als ich ihm ganz verlegen anvertraute, daß ich ja noch gar nicht male, meinte er: „Wie schade, Sie arbeiten ja schon so lange bei Baur. Ich hoffte, Sie malten schon und hätten mir dann eines Ihrer Bilder geben können; ich male so gerne auf bereits bemalte Leinwand, es ist eine soviel lustigere Arbeit. – Ich mußte so lachen, daß er mitlachte.“ –
Ließ mein Vater sich nun verleiten, über ein fertiges Bild statt eines Mondscheines ein neues Tagbild zu malen, so hat sich das doch mitunter gerächt, denn es kam vor, daß auf einmal, nachdem das Bild abgeliefert und weiterverkauft war, Pinienkronen, galoppierende Esel und dergleichen aus dem hellen Meeresspiegel oder gar aus dem Himmel herauswuchsen, und daß von den unglücklichen Besitzern jämmerliche Briefe einliefen, worin gebeten wurde, sie doch von den ungebetenen Gästen zu befreien.
Es konnte aber noch schlimmer kommen. Eines Tages trafen wir ihn im Atelier, wie er mit Hilfe des Schreiners sich vergnügte, ein ziemlich großes Bild in sechs gleiche Teile zu teilen, sie hatten sich eine ganz große Schere dazu besorgt. Es war kurz vor unserer Herbstreise, und wir begegneten den schön aufgerollten Stücken in Lugano in seinem Malkoffer: „Da mache ich Farbstudien darüber,“ sagte er mir, „dazu habe ich mir das präpariert.“
Wenn ein Bild jemandem, der ihm persönlich nahestand, besonders gefallen hatte, so widerstand er oft siegreich der Versuchung, es „umzustimmen“; oft stand das Bild schon auf der Staffelei, in diesem Falle auf dem Schafott. Johann, der Diener, hatte dann die Erlaubnis, warnend zu erinnern: „Herr Professor wollten aber nichts mehr an dem Bilde ändern, weil es den Herrschaften doch gar so gut gefallen hat,“ – dann hörte ich ihn wohl antworten: „Ich will auch gar nichts daran ändern, ich habe Herrn Schulte sogar versprochen, es morgen abzuliefern,“ oder: „Na, da nehmen Sie es in Gottes Namen wieder weg, das hatte ich ganz vergessen.“ Manchmal hieß es aber auch: „Her damit! Das kann alles nichts helfen.“
Das Zerstören der Bilder, die ihn nicht voll befriedigten, gehörte zu seinen „Lebensbedingungen“.
Bildertitel. Kunsthändler und Mäzen. Gefälschte Bilder und talentlose Akademie-Aspiranten.
Mein Vater dachte sich zu seinen Bildern gerne Romane aus: „Meine arme Maria“ hatte er das im Besitz des Grafen August von Bismarck befindliche Bild getauft; das Bild ist für uns alle „Meine arme Maria“ geblieben; eine kleine Dorfkirche, im offenen blumengeschmückten Sarge vor dem Portal die helle Gestalt der Braut, ein junger Bauer in verzweifeltem Schmerze über der Leiche liegend. Der Titel war eine Erinnerung an das Bild eines italienischen Malers, das ihm seinerzeit so gut gefallen hatte.
Zum Necken geneigt, alarmierte er auch wohl meine Mutter durch ganz phantastische Titel, die er seinen Bildern zu geben vorgab. Ich sehe ihn noch, wie er mit dem ernsthaftesten Gesicht von der Welt – in seinen Augen aber lachten tausend Schelme – erklärte: „Dem Klostergartenbild gebe ich den Titel „Fledermäuseschießende Mönche, vom „Engel des Herrn*)“ überrascht, oder ein andermal: der einsame Wanderer dort in der Kampagna ist Michel Angelo, also Michel Angelo auf einem Spaziergang in der Kampagna, in den Wolken nach Anregung zu seinen Kolossalleibern suchend.“ Einem etwas törichten Verwandten hatte er drei alte Weiber, die mit Spindeln am Strand von Neapel standen, als Parzen vorgestellt; der hatte nichts Eiligeres zu tun, als dies am Abend im Malkasten zu erzählen und dann höchst beleidigt anzukommen. Dort hätten sie ihn ausgelacht und gesagt, der Oswald habe sich über ihn lustig gemacht. Aber dies alles war ihm nur halbwegs scherzhaft, und er ironisierte sich und seine durchgehende Phantasie ja selbst am meisten.
*) Angelusläuten.
Vielfach wunderte man sich, daß mein Vater keine Privataufträge annahm. Es ist ihm dies auch oft verübelt worden, aber er hielt es mit seinen Kunsthändlern, die nahmen, was sie bekamen, und redeten ihm nicht in seine Malerei hinein. Das war das Letzte, was Oswald Achenbach vertragen konnte.
Ich erinnere mich eines Falles, den er später immer ins Feld führte, wenn er zu einem Kunstmäzen gesagt: „Gehen Sie zu Schulte, da haben Sie die Auswahl.“
Frau N.N. hatte ein Bild, ich glaube, einen „Palast der Königin Johanna“ von meinem Vater direkt gekauft. Meine Mutter hatte die Vermittlerin bei dem Kaufe gemacht und dieses oft genug bereut. Nachdem die Besitzerin des Bildes sich eine Zeitlang daran gefreut und begeistert darüber geschrieben hatte, kam auf einmal ein Brief, worin gebeten wurde, doch das „kleine Dampfschiff weg zu machen, es störe ihr und ihrem Gemahl die Poesie. Ob sie das Bild einschicken dürften.“ – Das Bild wurde eingeschickt, mein Vater besah es sich und meinte achselzuckend: „Das Dampfschiff kann ich nicht fortmachen, denn was nützt mich der ganze Golf von Neapel, wenn ich nicht darauf fahren kann!“ Der Dame schrieb er seelenruhig, sie bekäme ein anderes Bild und schenkte den „Palast der Königin Johanna“ einem Freunde. Es war eine unglückliche Geschichte, und die arme Dame tat uns allen leid, aber wer Oswald kannte, der war froh, wenn er sein Bild wirklich bekam und schickte es ihm nicht ein, um etwas daran zu ändern. Wenn meine Mutter und ich später einmal Miene machten, einem Kunstmäzen beizustehen, dann drohte er lachend: „Ich bitt’ euch, denkt an das Dampfschiff.“
Anlaß zu Ärger boten die vielen angeblichen Oswald Achenbachs, die fortwährend ins Atelier gebracht oder mit der Post eingeschickt wurden. Oswald ließ sich ja nicht leicht die Laune verderben; ich erinnere mich, daß er erstaunt vor einem Goldenen Horn stand, das ihm noch in den letzten Tagen seines Lebens als echter „Oswald“ vorgestellt wurde. Es war unglaublich, was sie seit Jahren alles herangeschleppt hatten. Einmal brachten sie einen heiligen Hieronymus, vor seiner Wüstenhöhle sitzend, und behaupteten, es sei eine Jugendarbeit Meister Oswalds. Kleine, nach Photographien zusammengestellte Bildchen, so gut wie möglich in Oswald Achenbachsche Töne gebracht, wurden zu allen Zeiten harmlosen Seelen angedreht. Der Verkäufer hatte natürlich gesagt, es stamme aus der Familie, in der Absicht, seinem Bildchen Kredit zu verschaffen. Oft genierte sich der Käufer zu fragen und war dann so lange im Besitz eines echten Oswald Achenbach, bis er es, um die Signatur bittend, ins Atelier brachte, wo dann herauskam, daß er hereingefallen war. Oswald sagte dann: „Wer nichts davon versteht, sollte nie versäumen, einen Sachkundigen zu fragen, ehe er sein gutes Geld ausgibt.“ Es kam aber auch vor, daß Sachen veruntreut oder gestohlen waren und somit wirklich aus der Familie stammten.
Ehrgeizige Väter oder Mütter, die, mit den schönsten Empfehlungsschreiben ausgerüstet, mit Studien, Skizzenbüchern und hoffnungsvollen Söhnen den Eintritt ins Atelier erzwangen, gehörten auch nicht zu den Annehmlichkeiten des Lebens und verdarben Oswald oft gründlich die Laune: „Herr Professor, wir richten uns ganz nach Ihrem Urteil,“ war eine meinem Vater sehr unsympathische Versicherung. – Er wies die Herrschaften auch meist an die Akademie, aber wenn absolute Talentlosigkeit vorlag, versuchte er die Eltern kurzweg von der Torheit ihrer Pläne zu überzeugen. Da kam es aber vor, daß sich die Leute nicht überzeugen lassen wollten. Ein Biedermann sagte ihm sogar einmal begütigend: „Sie müssen immer bedenken, Herr Professor, daß mein Sohn doch nicht so hohe Preise fragen würde wie Sie!“ „Solchen Leuten verständlich machen wollen, was ein „Künstler von Gottes Gnaden“ ist,“ meinte Oswald lachend, „das ist verlorene Liebesmüh’!“
Kunstanschauungen I Lehrtätigkeit
Kunstanschauungen
Obgleich mein Vater nicht gerne dozierte und nur selten über seine eigene Kunst und seine Kunstanschauungen sprach, kursierten doch in Freundeskreisen eine ganze Anzahl Aussprüche, die wohl nur zum Teil authentisch waren. Ich muß immer lachen, wenn ich daran denke, wie unser späterer Freund, der General Carl von Hugo, als junger Leutnant den Versuch machte, von Oswald in das Heiligtum seines Künstlersinns eingeführt zu werden. Ein Vierteljahrhundert später schrieb mir der General darüber: „Ich lernte Ihren Vater im Malkasten im Mai 1867 persönlich kennen, er befand sich an einem Tisch mit Knaus, Carl Hoff, Salentin, Baur, Hiddemann und dem Bankier Scheuer. Meine Begeisterung für die Größe seiner Kunst war schon längst eine unbegrenzte, und da der Saft einer großen Maibowle mir den Mut dazu gab, so bat ich das Barönchen (von Stutterheim), mich ihm vorzustellen. Das geschah. Er stand hinter Hoff und sah ihm in die Karten; dann gab er mir die Hand mit kurzem Gruß; aber meine Hoffnung, daß er mich nun in das Heiligtum seines Künstlersinns einführen würde, wurde arg zuschanden, denn plötzlich schrie er Hoff an, daß er ein ganz miserabler Kartenspieler sei, er hätte die blanke Zehn drauf geben müssen. Dann fragte er mich, „ob wir nun auf der Golzheimer Heide exerzierten, dort sei es wohl sehr staubig?“ – – – Enttäuscht kehrte ich zu meiner Maibowle zurück.“
Es hat Oswald zu allen Zeiten Spaß gemacht, seine Verehrer und Verehrerinnen zu mystifizieren. Aber seine Art war so harmlos, und jeder kannte ihn als Schelm, so daß die „Hereingelegten“ ihm selten böse wurden, sondern oft herzlich mitlachten.
Seine größten Verehrer aber waren die jungen Künstler, die ihn so gerne interpellierten. Die kannten ihn genau, sie waren ja seine besondern Lieblinge. Mit ihnen war er sehr sachlich und gar nicht ironisch, es kam auch vor, daß er mir auftrug:
„Schick mir nachher den „So und So“ noch einen Moment, er könnte mich mißverstanden haben.“
Später überzeugte mich dann ein Blick, wie eifrig sie waren und wie gut sie sich unterhielten.
Kunstdisputen ging mein Vater am liebsten aus dem Wege: „Wir wollen doch nicht fachsimpeln,“ suchte er stets zu vermitteln. Seine heitere Art bracht übrigens jedem schärferen Wortgefecht schon bald die Spitze ab. In der Zeit, wo „Modern“ für die einen das Losungswort, für die andern den Schlachtruf bedeutete, prallten ja sowohl im Malkasten, wie auch an den sonst harmlosen Gesellschaftsabenden selbst Freunde hart aneinander. Dann habe ich ihn wohl sagen hören: „Ach was, das sind alles Redensarten! Jeder tüchtige Künstler geht seinen eigenen Weg und muß Ellenbogenfreiheit haben. Natürlich beeinflußt der Zeitgeist, die Luft eines neuen Jahrhunderts, uns alle miteinander. Ich bin auch „Modern“ und danke Gott, meinem Schöpfer, daß ich mir die Quälerei mit dem feinen „ausmalen sollen“ vom Hals geschafft habe. Etwas anderes ist, daß das, war wirklich schön und gut ist, es auch für alle Zeiten bleibt, und daß schlechte Sachen aller Marktschreierei zum Trotz nicht gut werden.“
Charakteristisch für Oswalds Art, Kunstgespräche zu führen, ist folgendes Marienbader Abenteuer. Wir saßen im Garten „Zum alten Egerländer“ beim Nachmittagskaffee mit Ludwig Passini, dem Regierungspräsidenten von Eichhorn und andern. Mein Vater gab gerade strahlend eine Geschichte zum besten, die ihm der Komponist Meyer Hellmund am Morgen erzählt hatte, als ein Herr an unseren Tisch herantrat, sich als Major von NN legitimierte, feststellte, daß er mit Oswald Achenbach zu tun habe und dann ohne weiteres zu wissen wünschte, welcher Kunstrichtung er angehöre?
„Sehen Sie mal das erstaunte Gesicht von Papa!“ sagte mir Passini. Wir waren aber noch erstaunter, als mein Vater schlagfertig erwiderte: „Der südlichen Richtung, mein Herr, der südlichen, nach dem Norden hat es mich nie gezogen.“ Meiner Mutter tat der verdutzte Herr leid; sie lud ihn ein, Platz zu nehmen, und bot ihm sogar eine Tasse Kaffee an. Papa sagte dann entschuldigend, die Attacke habe ihn so sehr überrascht, doch sei er gerne bereit, jede gewünschte Auskunft zu geben. Er bewundere alles, was schön und anbetungswürdig sei und was ihm sonst gefiele, und ihm gefiele sehr vieles und sehr Verschiedenartiges und, wie gesagt: es ziehe ihn immer nach dem Süden. Die Sonne und das Schöne, das zöge ihn an: „Das sei seine Kunstrichtung.“
Als der Mann mit der Kunstrichtung, wie wir ihn nannten, erfuhr, daß der Herr da unten am Tisch der berühmte Passini sei, wollte er sich nun über diesen hermachen. Aber der sagte, er müsse nach Hause, nach dem jungen Hasen sehen, den er auf der Jagd beim Grafen Metternich in Königswart lebendig gefangen und den er mir schenken wollte. So brach man denn auf. Der „Mann mit der Kunstrichtung“ reiste in den nächsten Tagen ab. Wir sahen ihn nicht wieder, und der Hase wurde in den Wald zurückgebracht. Denn meine Mutter widersetzte sich energisch meinen Aufziehungsgelüsten. „Das Aufziehen“ (Necken) besorgt schon Papa,“ sagte sie.
An diesem Abend entging aber auch mein Vater seinem Schicksal nicht. Unser Stammtisch bei Klinger war ziemlich vollzählig: Passini, Rudolf von Bennigsen, der berühmte Führer der Nationalliberalen, Exzellenz von Griesinger aus Stuttgart mit Gemahlin und Töchterchen, mein alter Freund von Flügge-Speck und andere heitere Elemente waren anwesend. Unser Freund, der Regierungspräsident on Eichhorn (ein Schwiegersohn des Philosophen Schelling), gab das Nachmittagsereignis zum besten. Er sagte, mein Vater habe dem Interviewer einer neuen, berühmten Kunstzeitung anvertraut, daß er in der Kunst alles liebe, was hübsch sei, ob es nun tanze, sänge, mime oder an der Wand hinge, darin sei er nun einmal Don Juan.
Daß Oswald, dem Schönheitsdurstenden, heiter Genießenden, der alles Häßliche gern beiseite schob, grausame Bilder unsympathisch waren, kann niemand überraschen. Im Sommer 1897 umgingen wir im Glaspalast in München in weitem Bogen das Gemälde eines ungarischen Künstlers („eine ungarische Gräfin läßt junge Mädchen erfrieren)“; und in den Galerien sagte er mir oft: „Sieh es dir von weitem an, freu dich am künstlerischen Ensemble und an den schönen saftigen Farben, aber verschließ die Augen gegen das Sujet. Wie sollte man wohl froh sein, wenn man all das Elend auf sich wirken ließe?“ Er sagte oft: „Die Kunst kann nicht immer heiter sein, aber ob ernst, ob tragisch, sie soll erhebend und nicht abstoßend wirken. Diese grausamen Bilder sind von kranken und perversen Menschen erfunden und eine Rücksichtlosigkeit gegen das Publikum.“ –
Welches seine Lieblingsbilder waren, wüßte ich nicht zu sagen; er hatte ein großes Herz, war schnell begeistert, und so sehr er die alten Meister liebte und verehrte, stand er doch manchem „Modernsten“ verständnisvoll gegenüber.
Für Böcklin hatte er eine ganz besondere Vorliebe. Wieviel Mühe hat er sich gegeben, mir dessen Gemälde in der Schackgalerie lieb und verständlich zu machen. Ich habe es ihm nicht leicht gemacht und immer behauptet, gemeinsame schöne Erinnerungen aus Italien spielten eine Rolle in seiner Begeisterung; erst viel später konnte er mit mir zufrieden sein, und behauptete dann natürlich, das Spiel der Wellen habe mich unterjocht. Wir haben ihn mit seiner Liebe für Böcklin oft geneckt und ihm wohl lachend vorgeschlagen, seine Bilder auch mit „Meerweibern und Bockmännern“ zu bevölkern; dann hieß es aber: „Um Gottes willen, ich male immer nur, was ich mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Mich hat nur Positives begeistert.“ Sehr hoch stellte er Liebermann, sein Lieblingsbild war: Die Netzflickerinnen (in der Kunsthalle in Hamburg).
Auch Eduard von Gebhardt verehrte er sehr. Wie lange es sein Wunsch war, einen Gebhardt zu besitzen, geht aus folgendem, an mich gerichteten Brief Eduard von Gebhardts hervor: „Ich hatte mein erstes Bild „Einzug in Jerusalem“ schüchtern in die Welt gesetzt. Da kam Ihr Vater einmal auf der Straße an mich heran und fragte, ob ich schon Angebote auf mein Bild bekommen hätte, er habe große Lust, es zu kaufen. Die Sache kam später nicht mehr in Frage, denn der Kunstverein kaufte das Bild; aber Sie können denken, welchen Eindruck es auf den schüchternen Anfänger machte, daß der große, berühmte Achenbach ihm sagte, er hätte Lust, sein Bild zu kaufen. Ich fühlte mich so gehoben, und es war mir so wertvoll, daß ich das Geheimnis als köstlichen Schatz keinem Mensch mitteilte. Erst in späteren Jahren haben wir darüber gesprochen.“ – – –
Zu Oswalds besonderen Lieblingen gehörte auch Anselm Feuerbach. Selten habe ich meinen Vater so begeistert gesehen wie in Nürnberg im Sommer 1880. Damals hatte die Künstlerklause im dortigen Rathaussaal einen Teil des Nachlasses Feuerbachs zu einer Ausstellung zusammengestellt, darunter das „Urteil des Paris“ sowie noch viele andere interessante Bilder und ganz besonders die herrlichsten Frauenporträts. Wir waren von Kissingen, wo meine Mutter die Kur gebrauchte, nach Nürnberg hinübergefahren, denn mein Vater sagte, er würde es sich nie verzeihen, wenn uns dieser Genuß entginge. Wir haben in späteren Jahren noch oft und immer mit derselben Begeisterung dieser herrlichen Ausstellung gedacht. Als wir im Jahre 1888 bei Gelegenheit der großen Jubiläumsausstellung drei Wochen in München zubrachten, war die Erinnerung noch so frisch, daß wir überall nach Feuerbachschen Bildern und Erinnerungen fahndeten.
Von dieser Jubliläumsausstellung 1888 brachte ich ein reich gefülltes Tagebuch heim, und im Winter entstand ein illustrierter Katalog à la Spottvogel, den mein Vater und ich höchst eigenhändig klebten, und in welchem wir auch unsere Lieblingsbilder nicht geschont haben. Wir lernten damals durch den Präsidenten der Ausstellung, Prof. Eugen von Stiler, auch den Prinzregenten persönlich kennen, – und auf demselben Flur mit uns in den „Vier Jahreszeiten“ wohnte die Exkönigin Isabella von Spanien; kurzum, es war eine sehr interessante Zeit.
Wir waren natürlich den ganzen Tag in der Ausstellung, was unsere Freunde nicht verstehen konnten, besonders da an der Isar auch eine sehr schöne Industrieausstellung stand. Man müßte bei dem schönen Wetter doch auch spazieren gehen, behaupteten sie; aber wir sagten: „Wir machen unsere Spaziergänge im Glaspalast.“ Dort erwischte man uns dann gelegentlich auf einem bequemen Diwan, im Anblick des „Spiel der Wellen“ versunken, und da hieß es natürlich: Wir gingen nicht, wir säßen spazieren. Oswald aber, der seine Bonmots nicht zu Hause gelassen hatte, sagte lachend, auf den Böcklin deutend: „Ach was, Sie sehen doch, wir schwimmen in Vergnügen.“ Das haben wir allerdings in den folgenden Tagen oft hören müssen. Trotzdem verließen wir die Ausstellung nie, ohne noch einmal das „Spiel der Wellen“ besucht zu haben.
Großes Gefallen fand mein Vater auch an dem „Gorilla“ von Fremiet, der damals in München zuerst ausgestellt war. Meine Mutter und ich fanden aber diesen Gorilla, der ein Negerweib gestohlen hat und seine Verfolger mit einem großen Stein bedroht, höchst unsympathisch. Oswald hingegen behauptete, es sei eine Allegorie, und führte noch dies und das zu seiner Ehrenrettung an. Er brachte uns, die wir uns im Labyrinth, genannt Glaspalast, nicht so gut orientieren konnten, tückischerweise immer wieder zu ihm hin.
Sehr oft saßen wir vor dem „Nordenskjold“ vom Grafen von Rosen. Bei der schrecklichen Hitze, die damals in München herrschte und die auch allmählich in den Glaspalast drang, war uns der Anblick des so herrliche gemalten, kühl leuchtenden Schnees besonders wohltuend.
Damals erzählte mir mein Vater etwas, was mich in Erstaunen versetzte (meine Mutter hatte das allerdings schon lange gewußt), nämlich daß Oswald in seiner Jugend eine große Sehnsucht nach dem Norden, besonders nach Schweden und Norwegen gehabt hatte, daß er dort Studien machen und nordische Bilder malen wollte. Da seien Farben, habe ihm Gude erzählt, eine Himmelsbläue und eine Herrlichkeit, last not least die entzückendsten Mädchen in leuchtendster Tracht.“ – – Ich war starr, das hatte ich nicht geahnt.
Ich fragte ihn, warum er denn nicht nach dem Norden gegangen sei? Der Hauptgrund war, daß Andreas den Norden malte. Ich sagte ihm, Oswalds Norden würde wohl eher ein zweiter Süden geworden sein, das hätte ich schon von der Himmelsbläue und den leuchtenden Trachten der Mädchen weg. Er selbst aber meinte, er würde das schon sehr gut auseinander gehalten haben, nun sei es zu spät, sich darüber aufzuregen. „Du hast also den Mann mit der Kunstrichtung mystifiziert,“ um nicht zu sagen: „angelogen“, meinte ich. „Nicht im mindesten,“ sagte Oswald, „was ich euch hier vor dem Nordenskjold erzählt habe, sind Jugendträume, und Träume sind Schäume, wer weiß, wofür’s gut war.“
Merkwürdig ist, daß ein Schüler meines Vaters, der 1844 in Athen geborene Themistokles von Eckenbrecher, sich in späteren Jahren ausschließlich dem Norden zuwandte, nachdem er früher vielfach Bilder aus dem Orient gemalt hatte.
Meinen Vater hat der Orient nie gereizt. Oft ist diese Frage aufgeworfen worden, denn die Freunde, die vom Nil, von Kairo und Konstantinopel oder gar aus Indien und Japan heimkehrten, waren stets voller Begeisterung und bestürmten ihn. Dann hieß es: „Nein, Herr Professor, diese Blumenpracht! Diese Palmen! Dieser blaue Himmel! Das ist doch noch etwas ganz anderes als Italien. Sie müssen hin! Das ist auch heutzutage gar keine Reise mehr!“ Mein Vater jedoch erklärte ihnen, daß ihn nichts mehr nach dem Orient zöge. Zur Zeit seiner Freundschaft mit „dem guten Baron Prokesch“ würde er schon gerne einmal nach Konstantinopel und von dort mit diesem nach Ägypten gefahren sein, Prokesch habe ihn so oft dazu eingeladen. Aber wenn es auch wirklich dazu gekommen wäre, so glaube er bestimmt, daß er nachher doch wieder die Campagna gemalt hätte und den „Golf von Neapel“ oder „die errötende Jungfrau“ (so nannte er die „Jungfrau“ im Abendrot). Er möge keine braunen Menschen leiden und keine Moscheen. Für Kirchen sei die Gotik am schönsten. Der Mailänder Dom sei ein Gedicht, sowohl im Morgenduft wie im Mondenschein, und der Kölner Dom sei geradezu himmelanstrebend! Wenn jemand dann meinte, Minaretts seien auch himmelanstrebend, dann sagte er lachend: „Bilder vom Bosporus und Szenen aus Tausend und eine Nacht hätte meine Frau mir überhaupt nicht zu malen erlaubt.“
Viel Stoff zum Disputieren gab im Düsseldorfer Ausstellungsjahre 1902 der Klingersche Beethoven, dem besonders unsere militärischen Freunde feindlich gegenüberstanden. Natürlich war dann stets der Refrain: „Wir verstehen ja allerdings nichts von Kunst.“ Einmal sagte ihnen mein Vater: „Für Soldaten verstehen Sie alle mehr wie genug von der Kunst; bewundern Sie meine Bilder ruhig weiter und lassen Sie den Klinger in Frieden, der findet schon seine Anbeter.“
Er urteilte nicht gerne schnell, weder im Leben noch in der Kunst. Wie oft sagte er uns, als wir noch Kinder waren: „Ne jugez pas témérairement,“ und versuchte uns das unreife voreilige Urteilen abzugewöhnen. Wie oft hörte ich ihn auch in späteren Jahren sagen, daß man über eine Sache, die man noch nicht ganz in sich aufgenommen und verarbeitet habe, kein Urteil abgeben könne, ohne später in Widerspruch mit seinen eigenen Worten zu geraten. Denn viel Schönes würde uns nicht gleich klar, es müßte erst richtig erkannt und erfaßt sein: „Was würde wohl Carl Maria von Weber empfinden,“ meinte er, „wenn er wüßte, daß es ihm in Ewigkeit anhaftet, beim erstmaligen Anhören der C-Moll gesagt zu haben:
NOTENSCAN
„Beethoven ist verrückt geworden!“
Von verurteilender Kritik kannten wir zwei Äußerungen genau. Riß seine Geduld, so zuckte er die Achsel; mißfiel ihm etwas ganz, so lachte er. „Soll man denn da nicht lachen?“ beantwortete er wohl unseren fragenden Blick.
Wenn er bei unsern Besuchen in der Schulteschen Ausstellung ungeniert und vergnügt in seiner harmlos heitern und doch treffenden Weise die Bilder des lieben Nächsten besprach, folgte uns stets ein Trüppchen Ausstellungsbesucher von Bild zu Bild und amüsierte sich königlich; unseren Freunden machte es stets große Freude, ihn in die Ausstellung zu locken. Am liebsten hörten sie ihn aber über die Entstehung seiner eigenen Bilder erzählen, obgleich dann Sachen zutage kamen, die oft recht paradox erschienen.
Ein schriftlicher Gedankenaustausch zwischen ihm und andern Künstlern hat wohl kaum bestanden. Ich habe nie davon gehört und auch nichts darauf Bezügliches entdeckt. Aber alles, was er mir aus seinem Leben und über seine Kunst erzählt hat, habe ich immer gleich notiert, oft allerdings nur auf einen losen Zettel; fand mein Vater einen solchen als Lesezeichen, so sagte er wohl lachend: „Da hast du was Rechtes.“ Aber eines Tages meinte er doch: „Das ist ein ganz guter Gedanke; wenn Enkel und Urenkel etwas von mir wissen wollen, so sind sie nicht nur auf das Konversationslexikon angewiesen.“ Nun mußten wir aber beide lachen, denn die Bitten um Ausfüllung der Fragebogen für die Lexika wanderten stets unbeantwortet in den Papierkorb.
Lehrtätigkeit
Von seiner Lehrtätigkeit an der Düsseldorfer Kunstakademie hat mein Vater zu allen Zeiten gerne erzählt. Er hatte sich ihr mit großem Eifer gewidmet, so daß sein Interesse am eignen Schaffen zeitweise sogar in den Hintergrund trat. Die Kunsthändler jammerten, daß er die versprochenen Bilder nicht abliefere, und er ließ sie jammern; denn es lag ihm vor allem daran, daß seine Schüler auf den großen Ausstellungen mit Ehren bestehen sollten. Für sie war er ehrgeizig, eine Eigenschaft, die ihm für seine Person gänzlich fehlte.
Unser Freund Professor Kolitz erzählte einst: „Als wir Schüler zuerst davon hörten, daß Ihr Vater sein Lehramt niederlegen wollte, setzten wir uns hin und heulten!“ Oswald selbst erzählte mir folgendes: „Als ich im Jahre 1872 mein Amt als Professor an der Akademie niederlegte, da dachte ich: „So, nun adieu Jugend! – Fünfundvierzig Jahre war ich alt, bald ein halbes Jahrhundert hatte ich auf dem Rücken, und meine Kunsthändler und eure Mutter meinten, ich solle nun auch einmal an den „eignen Oswald“ denken. Ich habe mich dieser Raison gefügt und glaube, ich bin von meinem 50. Jahr ab Jahr für Jahr jünger geworden, wenigstens kam es mir so vor. Aller Verantwortung ledig, konnte ich nun nach Herzenslust malen! Aber mein Lehramt hatte mir doch sehr viele Freude gemacht, der morgendliche Besuch in der Akademie war immer eine frisch-fröhliche Ausspannung und Anregung, zugegeben, daß er mich viel Zeit gekostet hat.“
Einmal fragte ich meinen Vater, ob er mir noch einige Hauptsätze sagen könne, die er seinen Schülern eingeprägt. Da mußte er lachen und meinte, er habe allgemeine Lehrsätze nicht gepredigt, aber er habe ihnen immer sehr ernstlich ans Herz gelegt, ihre Zeit auszunützen, zur Arbeit sowohl wie zum Vergnügen; mit der ganzen Kraft der frischen Jugend zu versuchen, den Pelion auf den Ossa zu stülpen, – so hätte er das auch gemacht. Und neben dem Lernen sollten sie schon mal was verkaufen, das ginge ganz gut Hand in Hand; nichts sporniere so wie der Erfolg. Unter seinen Schülern sei eine ganze Anzahl reicher, junger Leute gewesen, aber auch solche, bei denen ein verkauftes Bildchen manch heimliches Entbehren endete: „Da hieß es den jungen Leuten (denn ich spreche von den ganz jungen) so schnell wie möglich ihre hinderlichen Malmethoden abzugewöhnen,“ sagte er, „ich machte das höchst rationell. Einem rief ich immer zum Jubel der anderen schon vom Korridor aus zu, lange ehe sein Bild für mich in Sicht war: „Um Gotteswillen nicht so braun, nicht so massiv, durchsichtiger, heller, lichter!“ Einmal aber war des Jubels kein Ende. Als ich nämlich nun sah, was auf der Staffelei stand, war es eine unberührte Leinwand. Aber der kleine Dicke hat nachher ganz schön gelernt, Wolken und Staub zu malen. Allmiteinander habe ich ihnen aber gepredigt: „Braucht keine zerstörenden Farben, das ist eine Unredlichkeit.“
„Einigen mußte ich täglich wiederholen: „Ich bitt’ euch, keine Fabrik, kein Süßholz, und wer malt da wieder mit Spucke!“ Sie konnten das Tüfteln nicht lassen. Andere hatten Freude an Scheußlichkeiten, und meinten, das sei malerisch. Denen habe ich oft gesagt: „Das gewollt Häßliche wirkt manchmal als Pikanterie, auf die Dauer hat aber keiner rechte Freude dran. Überlaßt denen das Häßliche, die nichts Hübsches machen können. Geschmacksverirrungen werfen ein schlechtes Licht auf Herz und Gemüt, sowohl bei der häßlichen wie auch der grausamen Darstellung, und ein ganz magerer und verhungerter Esel, – der auch noch gleich die Peitsche kriegt, – das ist nicht schön und auch nicht malerisch, denn das verletzt.“ – –
Einmal sagte er mir: „Einige Leute glauben, schmutzig und häßlich sei so ungefähr gleichbedeutend mit malerisch. Malerisch im allgemeinen Sinn hat mit hübsch und häßlich nichts zu tun. Für uns Künstler ist aber „malerisch“ eine Gefühlssache, die wie das Taktgefühl beim einen so weit und beim anderen so kurz entwickelt ist.“ –
Da ich aber gerne mehr vom „Malerischen“ hören wollte, erzählte er mir die Geschichte einer eleganten Römerin, die einer armen, jammernden, in Lumpen gehüllten Zigeunerin eine Lira reichte und kopfschüttelnd sagte: „Aber, liebe Frau, wie können Sie nur unglücklich sein? – Sie sind ja so malerisch!“ – Dann hielt ich mir die Ohren zu, denn die Geschichte kannte ich seit langem. Als ich ihn einmal fragte, ob seine Schüler auch immer zum Grafenberg und in den Bilker Busch gelaufen seien, sagte er mir: „Ich habe ihnen immer gesagt: „Probiert nicht im Atelier euch was zusammen zu komponieren, lauft hinaus und seht es euch an; lernt es auswendig, wenn ihr keine Zeit habt, es draußen zu skizzieren, und lauft dann schnell ins Atelier und malt es.“ Dies Rezept scheint mein Vater allerdings oft verschrieben zu haben; denn als ich Freunde und Schüler um Erinnerungen bat, wurde dies in Variationen immer und immer wieder erzählt. Einem Schüler, der sich draußen Heu und Stroh ansehen sollte, hatte er sogar gesagt: „Wenn Sie nun genau wissen, wie es aussieht, dann schnell zum Bild, und will Sie jemand zu einem „Bubbel“*) verleiten, so laufen Sie fort und rufen ihm zu: „Ich habe keine Zeit! Ich habe Heu und Stroh im Kopf!“ Ein anderer wurde auf die Wiese geschickt und hatte dann natürlich Gras im Kopf.
*) Unterhaltung.
Seine Schüler berichten alle gerne aus ihrer Akademiezeit und behaupten, mein Vater sei ein vorzüglicher Lehrer gewesen. Folgendes erzählte mir ein lieber Freund, der auch in seiner Jugend unter Oswalds Leitung an der Düsseldorfer Kunstakademie studierte:
„Wir holten Ihren Vater stets, wenn ein Bild fertig war und zur Ausstellung sollte. Immer kam er gerne und freundlich, aber beim Anblicke des Bildes kniff er dann oft das eine Auge zu, machte ein eigentümliches Gesicht, setzte sich und steckte sich umständlich eine Zigarre an, sprach und erzählte, anscheinend ohne Interesse für das Bild. Auf einmal sprang er auf, griff nach meiner Palette, öfters auch nur nach einer Tube Zinnober, Kadmium oder Kremser Weiß und setzte mit der Spachtel oder dem Daumen einen leuchtenden Klecks ins Bild hinein. Dann atmete er erleichtert auf. „Ja, das fehlte,“ sagte er, und wir sahen mit Staunen, daß das vordem leblose Bild erwacht war, – da schien ja auf einmal die Sonne!
Aber wenn wir dann versuchten, aus dem Kremser Weiß ein Kopftuch oder aus dem Kadmium ein sonnenbeleuchtetes Fenster zu malen, wie er geraten, dann war aller Sonnenschein wieder verschwunden, und wir versuchten zu ergründen, wie es kam, daß in seinen Bildern die Wirkung blieb, und wenn sie auch noch so fein ausgeführt waren!“
Wie wohltuend seine Art auf die jungen Leute einwirkte, geht aus folgendem Briefe des Baron von Türke (Dresden) an meinen Neffen Robert von Weiler hervor:
„Ich muß damit anfangen, es auszusprechen, wie wir Schüler alle an unserm verehrten Lehrer gehangen haben, nicht nur seiner persönlichen Liebenswürdigkeit wegen, sondern auch wegen seiner so interessanten und uns von großem Nutzen seienden Art zu lehren. Der Ernst, mit de er seines Lehramtes waltete, war so hübsch durch urwüchsigen Humor gewürzt, daß wir uns immer schon auf sein Kommen freuten.
Trat er mit einem fröhlichen „guten Morgen“ herein, so warf er seinen Mantelkragen über die Schulter zurück (irre ich nicht ganz, so setzte er seinen Hut in den Nacken) und ließ sich von uns Feuer geben, weil er ohne seine Zigarre nicht korrigieren könne. Und nun zogen wir mit ihm von einer Staffelei zur andern, um uns ja keine seiner Bemerkungen entgehen zu lassen.
Freilich wurde man bisweilen unter dem Gelächter der anderen rot, wenn man einen richtigen Wischer bekam; doch das traf ja den einen wie den andern und tat der guten Kameradschaft keinen Abbruch. Seine Hiebe konnten auch bisweilen recht kräftig sein, aber, wie gesagt, immer in so hübscher Art ausgeteilt, daß man sich doch nie gekränkt fühlte. Und dabei sprach er uns öfter sein Bedauern aus, daß er nicht so scharf sein könne wie sein Bruder; was der einem gesagt hätte, wäre man sobald nicht wieder losgeworden.“
Zigarre, Hut, Stock und Havelock spielten, wie’s scheint, eine große Rolle beim Korrigieren der Bilder. Professor A. Lutteroth (Hamburg), ein Schüler meines Vaters 1864–1867, schrieb mir über eine vorzügliche Karikatur, die er besitzt und die ein anderer Schüler meines Vaters, Carl Seibels, gemacht hat, die eine Szene darstellt, wie „Oswald im Havelock, Hut auf dem Kopf, Zigarre natürlich im Mund, Stock in der Hand, umgeben von Th. Hagen, Jacobi, Seibels und mir (Lutteroth), an einem Bilde demonstriert“.
Über meines Vaters Art zu unterrichten, hatte seinerzeit sein Freund und Schüler Professor L. Kolitz, bis vor kurzem Direktor der Kasseler Kunstakademie, ausführlich berichtet. Der Brief ist an meine Schwester, Frau von Borries (Kassel), gerichtet und lautet, wie folgt:
„Sie wünschen, verehrte Frau, daß ich über die Tätigkeit Ihres Vaters, des Professors Oswald Achenbach, als Lehrer berichten soll; ich will es versuchen mit dem Gefühl größter Dankbarkeit und Verehrung gegen den Mann, der meine Jugend zu wahrer Kunstanschauung geleitet hat und mich seiner Freundschaft würdigte. Seitdem ich sein Schüler, habe ich keine Arbeit begonnen und durchgeführt, ohne seiner Lehre bewußt zu sein.
Das Hauptgewicht in seiner Lehrtätigkeit legte Oswald Achenbach auf die Komposition in dem Sinne, daß das Motiv, die Gegenstände eines Bildes, sich der effektvollen Verteilung von Helligkeit und Dunkelheit, der geschmackvollen Wirkung der Farbentöne unterordnen müßten. Seine unerschöpfliche Kenntnis der Belichtungsbedingungen, der darzustellenden Gegenstände im Freien, seine Studien und sein Wissen von der Darstellung des Sonnenlichts zu jeder Tageszeit, auch des Mondlichts, die Belichtung der einzelnen Gegenstände, besonders auch des Figürlichen, der Menschen und Tiere durch den darüberliegenden Himmel, ob blau und Luft oder beleuchtete Wolken, gab ihm Gelegenheit und Fähigkeit, jedem Schüler die Farbe der Gegenstände des Bildes anzugeben, um sie zu natürlicher plastischer Wirkung zu bringen und die Schüler anzuregen, auf den Studienreisen diese Dinge selbst zu beobachten. Um sich verständlich zu machen, griff er manchmal zur Palette des Schülers und malte mit breiten Pinselstrichen, indem er den Lichteffekt des ganzen Bildes änderte, worüber der Schüler zunächst sehr unglücklich war; ein andermal versuchte er eine Einzelheit im Bilde zu größerer Vollendung zu bringen, um dem Schüler weiter zu helfen; das letztere geschah besonders selten, niemals aber bei den talentvollern und selbständigern Schülern, er wußte der Selbständigkeit, der besondern Begabung eines Schülers aufs äußerste zu folgen. Nebenbei verwies er auf die Bilder seines Bruders Andreas, auch auf die Kompositionen Turners.
Ein besonderes Fest war es für uns Schüler, wenn wir bei seinen großen Dekorationen, in Leimfarbe gemalt, zu den Musikwerken z. B. der Pastorale, des Oratoriums Paulus usw. mitarbeiten durften. Wir sahen staunend die Leichtigkeit der Komposition, sein Wissen und seine Geschicklichkeit, staunend nahmen wir wahr, wie Komposition und Farbengebung sich der musikalischen Idee anschlossen, sie offenbarten, selbst zu Musik in Farbentönen wurden.
Die Namen derer, die mit mir zu gleicher Zeit Oswald Achenbachs Schüler waren, sind: Theodor Hagen, Seibels, Hertel, Willberg, Calame (Sohn), Johannes Hermes, Wragge, Schneider, Harrer, von Bochmann und Lutteroth.“ – –
Professor Gregor von Bochmann äußerte sich folgendermaßen:
„Zur Zeit meines Eintreffens in Düsseldorf befand sich die Kunstakademie in einem Übergangsstadium. Direktor Bendemann hatte sein Lehramt an der Akademie aufgegeben, und es ging das Gerücht um, auch Professor Oswald Achenbach gedenke das gleiche zu tun. Da galt es für mich, so bald als möglich Schüler dieses Meisters zu werden. Wenn ich auch nur ganz kurze Zeit seine Lehrtätigkeit genossen, so ist mir doch die eindrucksvolle Art unvergeßlich geblieben. Dieselbe war auf das Wichtigste der bildlichen Darstellung, ich möchte sagen, auf das Gerüst des Bildes, wie sich dasselbe in Licht und Schatten aufzubauen habe, gerichtet. Zu diesem Zwecke skizzierte er oft mit Kohle an der grauen Wand unserer Klasse, wie er eine Arbeit eines Schülers, die er sich zur Korrektur ausersehen, gewandelt haben wollte. Hierbei ist zu bemerken, daß er meistens absah, über jede Arbeit etwas zu sagen. Er ging vielmehr mit sämtlichen Schülern der Klasse von Staffelei zu Staffelei, und nur, wo er glaubte, im Interesse der Gesamtheit etwas bemerken zu müssen, setzte seine Kritik ein. Diese sprühend lebendig, nicht selten ohne einen ironischen Beigeschmack. Dabei ergriff er oft Pinsel und Palette, und war es ein Vergnügen, zuzusehen, mit welcher Leichtigkeit er den oft trockenen Arbeiten zu leuchtendem Leben verhalf. In seiner Klasse wurde man nicht müde bei der Arbeit, er sorgte, daß man nur Lust am Malen bekam. Bei Fertigstellung eines Bildes sagte er: „Fangen Sie mit demjenigen Stück des Bildes an, über dessen Kenntnis Sie souverän verfügen, es wird ja auch gewöhnlich dasjenige sein, weshalb das Bild überhaupt gemalt wurde, und bringen Sie es in allem so weit wie möglich, dann werden Sie schon gezwungen sein, mit den andern Stellen des Bildes in der nötigen Ausführung nachzufolgen.“
Ich darf einen alten Freund meines Vaters nicht vergessen, der sich gern sein Schüler nannte, der aber doch aus den Jahren, wo man zulernt, heraus war. Er brache oft seine Bilder per Droschke ins Atelier. Mein Vater malte ihm dann einfach etwas „darüber“. Einmal hatte er mich gebeten, doch nach unserm Mittagsspaziergang mit meinem Vater in sein Atelier zu kommen. Sein Bild wolle nicht werden, und er müsse es in den nächsten Tagen abliefern. Wir gingen hin. Oswald war noch nicht im Atelier, als er schon rief: „ Aber wie kannst du denn so wüschte Weiber malen; wenn das junge Mädchen sein sollen, so müssen sie schlank sein, kleine Köpfchen und feine Hälschen haben, und das sollen doch junge Mädchen vorstellen. Die in der Ecke da, das kann schließlich eine Alte sein, aber sie hat trotzdem zu kurze Beine.“ Dann lobte mein Vater die Stimmung des Bildes, doch hieß es auf einmal; „Ich weiß nicht, aber ich mag den Kirchturm nicht.“ – – „Ich finde ihn sogar scheußlich,“ sagte unser Freund, halb lachend, halb wütend, „müßte ich das Bild nicht Ende der Woche abliefern, so hätte ich schon lange mit dem Fuß dadurch getreten.“ – „Ach was,“ sagte mein Vater, „hier genügen halbe Maßregeln, wir lassen ein paar Fahnen um den Kirchturm wehen, und über die häßlichen Balustren hängen wir einen schönen großen Teppich und die Mädchen, da sieh mal her“ – – – und schnell hatte er die Spachtel zur Hand und mit der Spachtel, schwipp, schwapp, schwupp, bekam jedes Mädel provisorisch von derselben Farbe eine Bordüre an den Rock und wurde dadurch gleich um einen Kopf größer. Und vom Kirchturm wehten bald ein paar lange Fahnen und verdeckten gnädig die Mängel der Architektur. Unser Freund war strahlend. Aber Oswald sagte ihm lachend zum Abschied: „Freund, laß dich beraten! Ob Kirchturm, ob Mädel, nimm dir nie ein häßliches Modell!“
Oswald Achenbach und die Musik I
Das Haus in der Goltsteinstraße
Oswald Achenbach und die Musik
Nach dem Malen nahm die Musik den größten Platz in Oswalds Herzen ein. Mit 18 Jahren war er schon unter den Gründern der Liedertafel. Nicht umsonst steht in der Malkastenchronik zu lesen:
Doch in Italiens Sonnenglut
Da taucht der Pinsel kühn
Sein Bruder Oswald wohlgemut,
Auch wirkt er – op der Bühn
Als strammer Buffo-Tenorist,
Sogar als Opernkomponist.
Schon im Jahre 1845 hatten sich die musikalischen Elemente unter den Düsseldorfer Malern zusammengeschart und die Künstlerliedertafel gegründet. Ihre Wiege stand nach Lüdecke in einer kleinen Bretterbude in der Nähe des früheren Bergisch-Märkischen Bahnhofs, also in der Gegend des jetzigen Apollotheaters. Aber schon seit vielen Jahren trafen sich die singenden Maler und Akademiker, Flamm und Oswald an der Spitze, zu den gemeinsamen Leberwurst-Abenden im sogenannten Rosenkränzchen. Das Rosenkränzchen ist eine heute noch bestehende, nahe der Großen Kirche gelegene Kneipe und hat ihren Namen von den vielen geistlichen Herren, die dort nach der Abendandacht (dem Rosenkranz) ihr Schöppchen tranken und gerne die Tür ihres Privatstübchens öffneten, um den frischen Stimmen zu lauschen, die ihre Quartette einübten, die beabsichtigten abendlichen Ständchen beredeten, ihre Studienausflüge festlegten und unter jubelndem Gelächter die Karikaturen ihrer Akademieprofessoren an die Wand malten. Dann kamen wohl die geistlichen Herren mit ihren Gläsern und Fläschchen zu ihnen herein, und ihnen zu Ehren gab es dann oft noch eine Extravorstellung. Denn frisch wie die Leberwurst und wie die warmen Berliner waren auch die Theaterstücke, die aufgeführt wurden, im Spielen erfunden. Die Rollen wurden verteilt, und man überraschte sich gegenseitig durch die Entwicklung oder Verwicklung des Stückes. Mein Vater meinte, sie hätten sich nie besser amüsiert als bei diesen improvisierten Aufführungen, es sei unglaublich, wieviel Unsinn man in der Jugend vertragen könne.
Theaterstücke schreiben und aufführen, war zeitlebens seine größte Freude. Oft sagte er mir: „Ich war fürs Theater geschaffen; schon als kleiner Bub hatte mich Derossi, der damalige Theaterdirektor in Düsseldorf, der mit meinen Eltern befreundet war, auf die Bretter gebracht. Mit Flügeln, Pfeil und Bogen habe ich als Amor im Lumpacivagabundus auf der Leiter der Fortuna gestanden, und dieser Leiter verdanke ich sicher das Glück, das mich im Leben begünstigt hat. Aber sie hat auch wohl meine Vorliebe und Begeisterung für alles, was Theater ist, verschuldet. Zum Oberregisseur oder Theaterdirektor hätte ich sicher am besten gepaßt, aber so recht aus dem Vollen heraus wie Goethe und Karl August.
Wir machten es wie sie, wir schrieben die Stücke selbst, wir spielten sie, ich gab meistens den Liebhaber. Goethe hat das ja auch getan; es sollte mich nicht wundern, wenn er mit Freu von Stein zusammen Kostüme für ihre Aufführungen gezeichnet und ausgesucht hätte. Bei uns mußten die Damen auch immer helfen, deine gute Mutter hat einmal an einem Nachmittage 45 Knappenkappen umgarnieren müssen. Auch den Regen mußten sie nähen, aus feinem Tüll mit Glasperlen. Die Dekorationen malten wir natürlich auch selbst, und außerdem komponierten wir uns die schönste Musik dazu. Meine Schüler und ich wußten manchmal nicht recht, waren wir Maler, Schauspieler oder Musikanten.
Die Liedertafel hatte lange kein eigenes Heim gefunden. „Es ging ihr wie der Liebe,“ sagte Oswald, „sie mußte wandern, von einem Ort zum andern.“ Sie vagabundierte und hat, bis sie sich schließlich als „singender Malkasten“ mit diesem verschmolz, vorübergehend in den verschiedensten Lokalen getagt.
„Es war im Jahre 1861,“ schrieb mir Eduard von Gebhardt, „damals wiederholte Ihr Vater im Malkasten die zauberhaften Szenen vom Sommernachtstraum. Ich wirkte als ehrsamer Frosch mit; mit sprühender Lebendigkeit leitete er die Sachen: hier sang er, dort ordnete er an, dort machte er einem etwas vor. Es war ja überhaupt eine interessante Periode in der Geschichte des Malkastens (Ihr Vater war die Seele vom Ganzen), wo die drei Männer: Ihr Vater, Max Hess und Julius Tausch alle möglichen Dinge in Szene setzten. Die „drei Blinden“ von Hans Sachs mit Mozartscher Musik, Shakespeares „Was Ihr wollt,“ „Wallensteins Lager,“ „Paulus“, vor allem die Pastoralsymphonie“, wurden in originellster Weise vorgeführt.“
Da war mein Vater allerdings in seinem Element. Wenn Freund Gebhardt aus dieser Zeit erzählte, wo er als ehrsamer Frosch im Sommernachtstraum mitgewirkt hatte, war auch er genau so demonstrativ wie Oswald. An einem Donnerstagabend stand er plötzlich vom Tisch auf und setzte sich zum Jubel der Bedienung platt auf die Erde, um zu zeigen, wie der Bettler im Paulus gesessen hatte oder hätte sitzen sollen. Daß mein Vater die Dekorationen selbst malte, habe ich schon erzählt. A. Lüdecke nannte diese Dekorationen kleine Bühnen-Kabinettstücke und meinte, solche seien in ihrer Qualität wohl an anderer Stelle nicht mehr gesehen worden. Am meisten bewundert wurden die Wandeldekorationen zur „Pastorale“ sowie die Bilder zu der Oper „Die Narren des Grafen von der Lippe“. Zu den „Drei Blinden“ hatte auch Andreas eine Dekoration gemalt, einen romanischen Klosterhof im Schnee, der alle entzückte und der jetzt noch im Malkasten vorhanden ist.
Für die großen Aufführungen, die sich einer besondern Popularität erfreuten, reichten nun aber weder die Bühne noch der Zuschauerraum des Malkastens aus. Da mußte der große Geißlersche Saal (der jetzige Rittersaal der städtischen Tonhalle) aushelfen, und in diesem Saale, wo Mendelssohn (1836) die Uraufführung seines „Paulus“ selbst dirigierte, brachte mein Vater vierunddreißig Jahre später zur 25jährigen Stiftungsfeier der Künstlerliedertafel den „Paulus“ auf die Bühne: als „dramatische Darstellung unter freier Benutzung des Oratoriums von Felix Mendelssohn-Bartholdy, erfunden und in Szene gesetzt von Oswald Achenbach.“ Regie Oswald Achenbach, dirigiert von Julius Tausch.
Die Dekorationen zum „Paulus“ malte mein Vater mit seinen Schülern gemeinsam. Ich erinnere mich lebhaft der riesigen Dekorationen, die im Skating-Rink-Lokal am Wehrhahn gemalt wurden. Bei den Paulusdekorationen malten Kolitz, Albert Hertel, Johannes Hermes und Theodor Hagen eifrigst mit. Meines Bruders größtes Interesse war das bewegliche Pferd, von Emil Hünten gemalt und von Otto Windscheidt, einer im Malkasten sehr populären Persönlichkeit, konstruiert, von dem Saulus, vom Blitz geblendet, heruntersinkt. Auch das Probieren des Blitzens war sehr unterhaltend. Oft trennte sich Saulus aber auch ohne Blitz vom Pferd. Der gute Salentin kühlte dann abends sein Mütchen an Paulus’ Pferde und Blitz und sagte lachend zu meiner Mutter: „Und wenn der Windscheidt noch so wütend ruft: „Pitter, jank blitze,“ der Blitz bleibt aus, aber der Paulus kommt herunter, und wenn ausnahmsweise der Blitzstrahl funktioniert, dann versagt die Mechanik vom Pferd, und der Saulus bleibt oben.“
Über die musikalischen Aufführungen, die mein Vater veranstaltete, hat einer seiner Schüler, Albert Lüdecke, einen hübschen Aufsatz geschrieben, dem ich folgendes entnehme: „Diejenige Korporation, für die Oswald Achenbach seinerzeit sich betätigte, war der Düsseldorfer Künstlerverein Malkasten. Billig erscheint es hier, vorweg zweier Männer zu gedenken, die Meister Oswald bei seinen Bühnendarstellungen wesentlich unterstützten. Es waren dies der von München aus früh nach Düsseldorf übergesiedelte Maler Max Heß und der damals an der Spitze jeder Musikbetätigung stehende Königliche Musikdirektor und hochbegabte geniale Komponist Julius Tausch. Der bei weitem Genialste bei diesen Unternehmungen war aber Oswald Achenbach selbst, auch in musikalischer Beziehung. Im Jahre 1850 wurde auf der kleinen Malkasten-Bühne die Burleske „Pannemanns Traum“ aufgeführt:
„Pannemanns Traum“
ein Opernragout von Oswald Achenbach mit ihm selbst in der Rolle als Pannemann.
Im April 1856 gelangte „Eulenspiegel und die drei Blinden“ von Hans Sachs zur Aufführung:
Eulenspiegel und die drei Blinden
Unter Benutzung Mozartscher Opern in Musik gesetzt von Oswald Achenbach.
Am 31. Januar 1861 als erste Aufführung:
„Die Pastoral-Symphonie“
von Ludwig van Beethoven mit begleitender landschaftlicher und pantomimischer Darstellung, letztere erfunden und in Szene gesetzt von Oswald Achenbach. Die Dekorationen gemalt von Oswald Achenbach. Die Symphonie dirigiert von Julius Tausch.
Am 2. April 1870 war die erste Aufführung des „Paulus“. Lüdecke erzählt darüber: „Dieses Unternehmen Meister Oswalds hatte beiläufig unter den Musikern viel Staub aufgewirbelt, ja stellenweise Stürme der Entrüstung entfesselt. Man sagte, es hieße die Grenzen der verschiedenen Künste verwischen usw. Der damalige Musikreferent und Kritiker der Kölnischen Zeitung, Bischof, hatte, als er nur erst davon erfahren, ohne noch etwas gesehen zu haben, einen geharnischten Artikel in obigem Sinne geschrieben. Nachdem er jedoch die nächste Aufführung besucht hatte und ihr mit vielem Interesse gefolgt war, brachte er ein sehr ausführliches Referat darüber und schrieb zum Schluß: „Man mag sagen, was man wolle, schön war es, doch!“
Ein endloses Disputieren gab es im Herbst 1888 im Marienbad zwischen meinem Vater und Josef Joachim über die Dramatisierung des „Paulus“, mit der dieser sich nicht befreunden konnte. Meine Mutter, Ludwig Passini, mit dem wir dort täglich zusammen waren, und ich hatten unser größtes Vergnügen, wenn die beiden, nachdem sie sich kaum begrüßt, gleich wieder im erbittertsten Kampf über den „Paulus“ lagen. Anders Rubinstein, der seinerzeit nicht ruhte, bis er eine persönliche Begegnung mit meinem Vater herbeigeführt. „Weil er sich unter allen Umständen mit ihm aussprechen müsse,“ und er erzählte später verschiedentlich, daß er den Atelierbesuch bei Oswald Achenbach nie vergessen, und daß er durch ihn einen ganz neuen Antrieb und neue Aufmunterung für seine Idee der geistlichen Oper erhalten habe.
Die Rheinisch-Westfälische Zeitung äußerte sich über den Einfluß, den die Musik auf Oswalds Kunst ausgeübt, folgendermaßen: „– – Es ist natürlich, daß sich eine Kunst, die im Hause des Meisters an erster Stelle gepflegt wurde – die Musik – auf die künstlerische Sprache des sensiblen Künstlergemütes Einfluß gewinnen mußte, hat er doch in seinen besten Jahren in Gemeinschaft mit seinen Freunden, dem Musikdirektor Tausch und dem Figurenmaler Heß, sogar den „Sommernachtstraum“ und den „Paulus“ von Mendelssohn selbständig auf die Liebhaberbühne gebracht. So kommt es, daß durch seine Bilder ein geschlossener Zug, ein harmonischer rhythmischer Klang geht, gleichsam, als wenn die Musik auf sein künstlerisches Tun und Lassen bestimmend eingewirkt hätte.“ –
Der „Paulus“ blieb übrigens die letzte der Aufführungen, die mein Vater veranstaltet hat.
Das Interesse an der Liedertafel schwand dann mehr und mehr aus seinem Leben, aber ein treues Andenken hat er ihr stets bewahrt; denn alle Erinnerungen einer heitern Jugendzeit waren mit ihr verknüpft.
Das Haus in der Goltsteinstraße
Unser elterliches Haus lag an der schönsten Stelle der Goltsteinstraße, einer der schönsten Straßen in Düsseldorf. Oswald war auch nicht wenig stolz auf das Haus, das er sich selbst gebaut, und das abendliche Sitzen auf der Terrasse mit dem Blick in den schönen, großen Garten mit seinen alten Bäumen und farbigen Blumenbeeten machte ihm viel Freude. In früheren Jahren beteiligte er sich auch eifrig auf der grünen Rasenfläche an Federball- und Reifenspiel und war sehr geschickt dabei. Er und seine Brüder waren ihrer Zeit die Champion-Schlittschuhläufer in Dsseldorf gewesen. Nach Arbeitsschluß führte er meine Mutter treulich durch die verschlungenen Gartenwege, auf Schritt und Tritt begleitet von der gelben Lieblingsdächsin „Nina“ und dem zahmen Reh, in späteren Jahren von den persischen Windhunden und Collies. Nur der weiße Terrier „Spot“ beteiligte sich nicht an der Promenade, sondern wälzte sich in den Blumenbeeten, und Oswald konnte natürlich nicht umhin zu bemerken: „Wer den „Spot“ hat, braucht für den Schaden nicht zu sorgen.“
An Sonn- und Donnerstagen war stets offenes Haus. Wenn das Wetter es erlaubte, versammelte man sich im Garten. Da konnte unangemeldet kommen, wer einmal aufgefordert war, und da auch unaufgeforderte Leute kamen, und diese auch wohl andere animierten, so war das Durcheinander manchmal groß, die Stimmung aber immer äußerst heiter, natürlich hauptsächlich in den früheren Jahren. Da konnte es Oswald nicht toll genug kommen, und der Ernst des Lebens lag ihm und uns allen absolut fern. Da gab’s im Garten „Zauberfeste“, oder es wurde Kirmes gemacht, mit richtigen Buden, Lebkuchenherzen und Orgeldrehern. Auch die winterlichen großen Feste, wo die Ulanen oder Husaren zum Tanze bliesen, machten ihm große Freude. Dann wurden Farbskizzchen ausgelost und ausgeschossen. Mein Vater hatte eine Werfkegelbahn eigens dazu konstruieren lassen, die wurde im Tanzsaal aufgestellt, und im Wintergarten wurde ein Scheibenstand errichtet. Am Festabend selbst wachte er dann mit Argusaugen über seine Skizzen, manchmal spielte er auch etwas Vorsehung, und dann konnte man sicher sein, daß die hübschesten Frauen auch die besten Skizzchen bekamen.
Obgleich die Maler bei uns aus- und eingingen und zu unsern Intimsten gehörten, wie wohl in keinem anderen Düsseldorfer Künstlerhause, stand die Casa Achenbach doch im Verdacht, ihren Hauptverkehr aus Militär- und Fürstenkreisen zu beziehen; dies ist oft von Fernerstehenden betont worden. Da aber Sohn, Schwiegersöhne und Vettern entweder aktiv oder als Reserveoffiziere dem in Düsseldorf garnisonierenden Husarenregiment Nr. 11 angehörten, so ergab sich ersteres von selbst. Und was die Fürstlichkeiten anbelangt, so hätte ich den sehen mögen, der sich nicht über den zwanglosen Verkehr mit so reizenden Frauen, wie z. B. die Prinzessinnen Heinrich XIII. Reuß und Wilhelm zu Sachsen-Weimar oder wie die Fürstin Tiny Salm von Schloß Dyck und ihre entzückenden Töchter, gefreut hätte!
In früheren Jahren waren nach den Malkasten- und Liedertafelabenden stets heitere Zusammenkünfte gewesen. Da vereinigte ein solides Abendessen und eine Mai-, Erdbeer- oder Pfirsichbowle all die Elemente, die bei den Aufführungen beteiligt waren oder ihnen Interesse entgegenbrachten. Unsere liebsten Erinnerungen knüpften sich aber an die harmlosen Donnerstagabende, da führte Salentin das große Wort, seine Schlagfertigkeit und sein Humor waren stadtbekannt.
Auch meinen Vater disputieren zu hören, war sehr lustig. Wenn General von Loë, Excellenz von Schreckenstein und Emil Pohle ihm ihren Witz entgegenzustellen suchten, kamen wir oft nicht aus dem Lachen heraus. Dem General war durch seinen Aufenthalt in Paris, Madrid und Petersburg das Beste in der Kunst bekannt. Auch er liebte diese Dispute sehr. Es waren keine regelrechten Kunstgespräche, und jeder konnte sich fröhlich am Kampfe beteiligen. Wir Damen hetzten dann, soviel wir konnten, denn es war viel amüsanter, wenn sie über Kunst und nicht über Politik sprachen. So manches, was früher nie zur Sprache gekommen war und was mich jetzt freut zu wissen, erfuhr ich bei solcher Gelegenheit, z B. daß mein Vater in der Plastik die Venus von Milo und den Moses von Michelangelo über alles stellte, und daß er eine unbegrenzte Bewunderung für Leonardo da Vinci hatte. Als sie aber eines Abends Devisen und Aussprüche großer Männer besprachen und Leonardos Lieblingssentenz erwähnt wurde: „Armut, Krankheit, was bist du gegen Langeweile?“ da schalt Oswald seinen heißgeliebten Leonardo einen Esel und meinte: „Bin ich gesund und reich, dann garantiere ich euch, daß ich mich sicher nicht langweile.“ Auch den Ausspruch, den Goethe Philine in den Mund legt und den der General so gern zitierte: „Wenn ich dich lieb habe, – was geht’s dich an?“ beanstandete er für seine Person und sagte, ganz entschieden: „Das wäre noch schöner, wenn die Philine mich lieb hat, so soll mich das auch was angehen.“
In seinen letzten Lebensjahren wurden so manche Erinnerungen zwischen ihm und gleichalterigen Freunden wach. Wenn sie von Paris sprachen, wo der General mehrere Jahre Militär-Attaché bei der deutschen Botschaft gewesen war, so kamen die schönsten Geschichten zutage. Mein Vater und er kannten alle Pariser Potins aus jener Zeit. War Salentin anwesend, so ging auch ihm das Herz auf; sein Aufenthalt in Paris zur Zeit der großen Ausstellungen unter Napoleon III., in Begleitung seines Freundes und Kunsthändlers Ed. Schulte, der auch meines Vaters Freund und Kunsthändler war, gehörte zu den schönsten Erinnerungen seines Lebens. Dann zitierte Salentin aus der Malkasten-Chronik:
„Es geschah vor alten Zeiten,
Daß der Kaiser von Paris
Sich von nahem und von weitem
Viele Bilder schicken hieß.“
Oder: „Oswald Achenbach, aimable,
Find’ sein Bild ich und très beau,
Gebt mention ihm honorable
Die Familie kriegt sonst trop!“
Und dann priesen sie die Schönheit der Kaiserin Eugenie und die Liebenswürdigkeit der Prinzessin Mathilde. Kamen sie auf den Louvre und seine Herrlichkeiten, so wurde auch oft und rühmend des damaligen Intendanten, des Grafen Nieuwerkerke, gedacht. Ich hielt ihnen wohl vor, was Henri Rochefort in den Abenteuern seines Lebens über Nieuwerkerkes künstlerische Untaten erzählt, da hieß es unisono, Rochefort sei ein Krakeeler, – und das stimmt ja.
Traurig war es für den lebenslustigen Oswald, daß meine Mutter eigentlich immer leidend war und eine große nervöse Angst vor Gewittern hatte; es war ihr unmöglich, den Anblick des Blitzes zu ertragen. Viele Ärzte waren vergebens konsultiert worden. So ließ mein Vater, als er das Haus in der Goltsteinstraße baute, einen tiefen, vollständig isolierten Kellerraum mauern, da sah sie keinen Blitz und hörte keinen Schlag. Die Kehrseite der Medaille aber war, daß Oswald, sobald es donnerte, mit in den Keller mußte. Gewitterte es in der Luft, türmten sich die Wolken, dann trat er immer und immer wieder auf den Balkon hinaus, bis es schließlich hieß: „Ich glaube, wir gehen am besten hinunter.“
Die Gewitterangst hatte sich bei meiner armen Mutter von Jahr zu Jahr gesteigert. In den letzten zehn Jahres ihres Lebens ging es auch nachts in den Keller. Unser schottischer Collie Bruce teilte ihre Nervosität. Donnerte es in der Nacht, so raste er laut bellend durch das Haus und fühlte sich erst frei und geborgen, wenn auch er von der Kellerpartie sein durfte. Kam dann der Sommer, so sagte mein Vater mit einem Seufzer: „Jetzt muß ich mal einen tüchtigen Gewittersturm malen, meine Frau muß sich allmählich doch wieder an die Gewitter gewöhnen.“ Und dann malte er einen Gewittersturm, der den Staub häuserhoch wirbelt, die Bäume zu brechen scheint, dem Abate die Pelerine über den Kopf schlägt, und wo die Frauen, die ihre Wäsche retten möchten, mitsamt den vom Sturm getragenen Laken über die Hecken zu fliegen scheinen. Meine Mutter gewöhnte sich aber nicht an die Gewitter, und so versuchte Oswald ein anderes Mittel. Er stellte ein Gewitterbild als Warnung und Beschwörung dem großen Balkonfenster gegenüber und behauptete mit dem ernsthaftesten Gesicht von der Welt, dann würden die Gewitter vorüberziehen. Das Bild mit dem Grabmal der Horatier und Curiatier mit den grün-braunen Gewitterwolken und den Pilgern, die unter dem Grabfelsen Schutz gesucht, stand lange als „Beschwörer“ auf der dritten Staffelei und erregte die Lachlust unserer Freunde.
Oswald kehrte allmählich zum Sonnenschein zurück. Sagte man aber: „Gottlob, du hast ja gut Wetter auf der Palette,“ da konnte man sicher sein, daß er im Handumdrehen ein paar bedrohliche Wolken an den Horizont strich.
Oswald Achenbach als Mensch I Auf Reisen
Oswald Achenbach als Mensch.
Oswald war so recht der Sohn seines Vaters, des alten Hermann Achenbach, der da sang:
*)“Was die Reis’ gekost’,
Frißt nicht Wurm noch Rost,
Denn es ist verschwunden;
Aber wenn mein Geld auch schwand,
Hab’ ich doch in jedem Lang
Anderes stets gefunden.“ – – –
Daß ein Sohn Hermann Achenbachs ein guter Rechner sein sollte, konnte schlechterdings nicht verlangt werden. Nein, mein Vater war kein Rechner! Leben und leben lassen war für ihn die erste Bedingung einer behaglichen Existenz. Allen Eindrücken leicht zugänglich, war ihm Wohltun eine Freude. Wurde er angegangen, so gab er gern und gleich. Er war auch ein fröhlicher Steuerzahler und guter Patriot, seinem Königshause treu ergeben. Vom Weltfrieden hielt er nicht viel und lachte Onkel Flamm, der die Abschaffung des stehenden Heeres befürwortete, freundschaftlich aus. Er nannte ihn einen Schwärmer und fragte wohl: „Wer soll denn mit der Abrüstung anfangen? Wir vielleicht? da würden sie schön von allen Seiten über uns herfallen.“
*) Aus Großvaters Reiseliedern.
Mit besonderer Befriedigung gedachte er stets des geeinigten Deutschlands. Er hielt das Deutschtum sehr hoch und meinte, die Lichtseiten überwögen im Charakter des deutschen Volkes. Auch die deutsche Sprache bewunderte er und freute sich der kraftvollen deutschen Schrift. Er wollte nicht davon hören, daß die lateinische allgemein eingeführt werden solle. Hingegen mochte er sich nicht an die neumodische Verdeutschung fremder Wörter, die sich in unsere Sprache eingebürgert hatten, gewöhnen. Er gebrauchte französische und englische Worte und Aussprüche mit Vorliebe. Bei uns am Rhein, besonders in der Kunstsprache (man lese nur die Malkasten-Chronik) wurde ja „ein bißchen Französisch“ stets als angenehm und abwechslungsreich empfunden. Noch in seinen letzten Lebensjahren trieb er eifrigst Italienisch und Englisch, um nicht die Gewöhnung zu verlieren. Das Französische beherrschte er absolut. Daß er es in den nordischen Sprachen nicht weiter gebracht, lag in dem Mangel an Gelegenheit. Die Lieder und Aussprüche, die er kannte und gern zitierte, verdankte er seinem Jugendfreund Hans Gude.
Oswald liebte ein scharfes Wortgefecht über Musik, Politik und soziale Fragen, aber über Religion und Konfession liebte er nicht zu räsonieren. „Darüber zerbrech’ ich mir nicht erst den Kopf,“ meinte er, „das überlass’ ich der geistlichen Obrigkeit, das ist der ihr Metier.“
Hatte er sich seine Meinung gebildet, so war er übrigens nicht leicht davon ab zu bringen. Auf einen Disput ließ er sich dann gar nicht ein. So waren ihm z. B. Automobile zuwider; er fand sie unelegant, und als ein Bekannter, der ein enragierter Autofahrer war, ihm einen längeren Vortrag über die Möglichkeit der Eleganz auch bei einem Auto halten wollte, stand er plötzlich auf und sagte: „Ja, für jemand, der Eile hat, mag ein Auto prachtvoll sein.“
Auch die Schreibmaschine mochte er nicht leiden und erledigte sie mit dem Ausspruch: „Gut für Geschäftliches,“ und als jemand behauptete: „In zwanzig Jahren tippen wir alle,“ tat er ganz erschrocken und meinte: „Da soll uns Gott behüten; wir armen Gefühlsmenschen können uns dann ja nicht mal mehr einen Schmerz von der Seele schreiben; denn daß man sich einen Schmerz von der Seele tippen kann, soll mir keiner weismachen.“ Ein großes Interesse brachte er aber schon als Kind der Luftschiffahrt entgegen. Als wir den Leonardo da Vinci von Mereschkowski lasen, sagte er mir: „Wie gerne würde ich mit ihm zusammen experimentiert haben.“ Seit seiner Kindheit bis ins hohe Alter träumte er immer und immer wieder, er habe das Fliegen richtig erlernt. Manchmal spielte er allerdings auch Ikarus und erwachte mit einem Schrei. Dann behauptete meine Mutter natürlich, er habe Alpdrücken.
Oswald hatte sehr viel Sinn für Humor, Komisches entging ihm selten. Ich glaube, es war in Luino, als wir ihn eines Morgens mit pfiffigem Lächeln im Speisesaal des Hotels auf und ab wandeln sahen. Wir dachten, er würde uns eine komische Geschichte erzählen; aber er gab nur meiner Mutter den Arm und führte sie denselben Weg, den er gegangen, von der Tür zum Fenster. Ich ging hinterher und mußte hellauflachen: „Ach Gott, wenn das doch Onkel Flamm sehen könnte, euer geliebter Garibaldi!“ Auf dem Platz vor dem Hotel stand eine große Statue Garibaldis. Da die Scheiben des Fensters vollständig wellig waren, sah es aus, als ob der Freiheitsheld einen Schwipps habe und dem Beschauer entgegentorkele. Wenn mein Vater, der in den letzten Jahren so oft der Jugendfreunde und ihrer gemeinsamen Streiche gedachte, vom Jahre achtundvierzig und von der ersten italienischen Studienreise erzählte, dann gedachte er auch des begeisterten Amerikaners in Rom, der auf die Leiter gestiegen war, um den kranken Freiheitshelden zu sehen, und lachend fügte er, jener Episode in Luino gedenkend, hinzu: „Aber wir haben ihn ja auch durchs Fenster gesehen.“ –
Knaus, Gude und Flamm hat er die Jugendfreundschaft bewahrt, obgleich das Leben ihn schon früh von Gude, später auch von Knaus räumlich getrennt hat. Auch Des Coudres’ hat er sich oft freundlich erinnert, aber Hans Gude war ihm besonders ans Herz gewachsen. Noch in seinen letzten Tagen sprach er mir von ihm: „Hans Gude hat mich Beethoven lieben gelehrt,“ sagte er, „damals war ich so jung, so eindrucksfähig, und so viel Musik brauste über mich weg; nachdem er mich aber das Allegretto aus der „A-Dur“ verstehen gelehrt, habe ich einen anderen Maßstab an alle Musik gelegt.“
Wie herzlich sein Verhältnis zu Flamm geblieben, beweist folgender Brief, den dieser mir bei Gelegenheit des Todes meines Vaters schrieb:
„Durch die Gewalt der Umstände habe ich mit euch Lieben seit dem Tode eures teuren Vaters nicht in den Verkehr treten können, den ich ersehnte. Ich möchte euch als Kinder des Verklärten, des großen edlen Menschen und Freundes, in dessen Charakter nichts Kleinliches Raum fand, dessen Leben das Ausstrahlen einer Gottesmission war, meinen eignen großen Schmerz des Abschiedes von ihm anreihen. Dem Schicksal bin ich aufs höchste dankbar, daß ich den Vorzug genießen durfte, ihn früh kennen und lieben zu lernen und später ein langes Leben ihm nah zu sein. Und nun der schöne harmonische Schluß seines so tätigen, Freude, Liebe und Licht spendenden Wesens und Lebens!“
In den späteren Jahren standen meinem Vater unter den Künstlern der Petersburger Alexander von Bogoluboff, Hermann Krüger, Salentin Kolitz, Camphausen, Georges Oeder und Emil Hünten am nächsten. Mit seinen Kollegen, den anderen Professoren, hat er stets die freundschaftlichsten Beziehungen unterhalten, sie hatten ihn alle gern. Camphausen hat ihn sogar zweimal angesungen.
Seine Lieblinge aber waren die Jungen! Der Erfolg der Jugend begeisterte ihn bis ins hohe Alter. Als unsere jungen Freunde Wendling und Ungewitter im Jahre 1902 bei Gelegenheit der großen Kunst- und Industrie-Ausstellung in Düsseldorf das Panorama „Caub“ gemalt, war er ganz gerührt. Er lud die jungen Freunde zum Abend ein und legte jedem einen Lorbeerzweig an seinen Platz. Die Jungen fühlten sich auch stets besonders zu meinem Vater hingezogen. Sie wußten, daß er sie liebte, sie fühlten, daß er sie verstand. Seine ganze Persönlichkeit atmete ja Heiterkeit und Leben, und seine Unternehmungslust kannte keine Schranken. Auch für unsere kleinen Interessen, für unsere Pläne und Vergnügungen hatte er stets Verständnis; einen Spaß hat er uns nie verdorben, „zu viel“ Vergnügen kannte er nicht. Übrigens konnte mein Vater sehr heftig werden; als Kinder zitterten wir dann vor ihm, bis wir dahinter kamen, daß es nicht so schlimm gemeint war, und dahinter waren wir sehr bald gekommen.
Oswald war ein Lebenskünstler, das Häßliche übersah er gern, und wo er ohne Ärger auskommen konnte, tat er diese sicher. Nörgeler waren ihm unsympathisch. „Gelt, Kind, die schaffen wir uns vom Hals,“ schlug er vor, und es bleib nicht beim Entschluß. Daß niemand so liebenswürdig und anregend zuhören konnte wie er, darüber waren sich alle einig.
Besonders betont wurde stets seine Bescheidenheit, aber ich glaube, mein Vater war nicht bescheidener, als es sich für einen wohlerzogenen Menschen schickt. Sein Hang, sich selbst zu ironisieren, sein Mangel an Ambition und die seinem Wesen eigene Zurückhaltung wurden oft falsch gedeutet. Hier muß ich hinzufügen, daß seine Zurückhaltung nicht mangelhaftem Interesse für seine Umgebung entsprang, sondern vielmehr daraus, daß Geist und Phantasie zu vielbeschäftigt waren, um seiner Umgebung besondere Aufmerksamkeit widmen zu können, eigentlich malte er ja im Traum wie im Wachen. Oft machte er auch während der Mahlzeit oder einer Spazierfahrt die Bewegung des Pinselführens, sogar im Theater sah ich dies, und doch war das Theater seine liebste Zerstreuung. Rührend gut, wie er war, hatte er meiner Mutter zuliebe auf Konzerte und Theater viele Jahre lang verzichtet, dafür aber hatte ihm diese eine Häuslichkeit geschaffen, die ihm alles andere ersetzen konnte. Unser Freund, Papas Beichtvater Pater Paulus von Loë, schrieb mir sehr treffend über die Art der Geselligkeit, die in unserm Elternhause herrschte, und über meines Vaters Art im Verkehr: „Wie gerne denke ich an die schönen Stunden zurück, die ich in dem so behaglich ausgestatteten Künstlerheim an der Goltsteinstraße zubringen durfte. Es war eine, in ihren Interessen und Berufen oft ganz verschiedene Gesellschaft, die bei Ihrem Vater verkehrte. Nicht bloß die Spitzen der Düsseldorfer Künstlerschaft, sondern auch Staatsmänner und Offiziere, ernste Gelehrte und Schriftsteller fanden sich dort zusammen und alle fesselte und entzückte die Gastfreundschaft, die ihnen hier geboten wurde. Die Unterhaltung war ungezwungen und oft sehr animiert, aber zugleich anregend und belehrend. Ein vornehmer und doch gemütlicher Ton herrschte, bei dem alle Gäste sich wohlfühlten, mit Bedauern gingen und gerne wiederkamen. Alle fanden in Oswald Achenbach einen liebenswürdigen Hausherrn und ausgezeichneten Gesellschafter. Nichts war seiner heiteren zwanglosen Art widerwärtiger als zeremonielle Redensarten. Er ließ auch andere gerne zu Worte kommen; aber, wenn er sprach, so pflegte er, wie man zu sagen pflegt, den Nagel auf den Kopf zu treffen. Wenige Worte von ihm reichten hin, um künstlerische Probleme oder auch Fragen des praktischen Lebens, die gerade besprochen wurden, zu erleuchten und zu lösen. Und dann überließ er es oft andern, seine Gedanken zu entwickeln, und spielte selbst den aufmerksamen Zuhörer. Freilich, wenn man ihm, wie es mir ja oft vergönnt war, auf sein Atelier folgen durfte und ihn dann inmitten seiner Kunstwerke an der Arbeit sah, so fühlte man gleich an der Begeisterung, die sich dann auch in seinen Worten und seinem ganzen Wesen kundgab, welch ein gottbegnadigter Künstler er war. – – –„
Oft wurde meiner Mutter gesagt: „In Ihrem Hause ist alles so üppig,“ – – sie hatte dafür nur ein Achselzucken. Mein Vater haßte halbe Maßregeln, wie er das nannte. Alles, was nicht aus dem Vollen und vom Allerbesten war, empfand er unangenehm. So war er zum Beispiel bei der Auswahl von Blumen des Morgens am Brunnen in Karlsbad, Marienbad und Kissingen unglaublich kritisch: „Am schönsten ist eine tadellose Rose,“ pflegte er zu sagen, „aber auch ein Strauß kann schön sein, nur muß er dann auch wirklich etwas vorstellen.“ Onkel Andreas brachten wir zu seinem 87. Geburtstag 87 La France-Rosen. Das war ein Strauß nach Oswalds Herzen. Andreas hielt ihn lange in seinen Händen: „Wirklich 87 Rosen, und“, sagte er, „meine Lieblingsrosen!“ Das hatten wir natürlich gewußt.
Die Mißverständnisse, die lange Zeit das gute Einvernehmen der Brüder getrübt hatten, waren allmählich vergessen worden. Seit vielen Jahren bestanden die freundschaftlichen Beziehungen. Mein Vater hat seinen Bruder stets sehr geliebt, und seiner Kunst hat er die größte Bewunderung gezollt; aber Oswald war eben zwölf Jahre jünger als Andreas, dadurch war in der Jugend der Respekt vor dem älteren Bruder vorherrschend. Andreas war schon ein berühmter Mann, als Oswald lernend in das Leben trat.
Eines Tages sagte mir mein Vater: „Solltest du wirklich dazu kommen, deine Notizen zusammenzustellen, so mußt du nicht vergessen, zu erwähnen, daß ich blond war, denn merkwürdigerweise halten mich viele Leute für dunkel. Mein heutiger Atelierbesuch, die hübsche Wienerin, die zwei große Bilder von mir besitzt, sagte mir nämlich, sie und ihre Freundin hätten geglaubt, ich sehe aus wie der fliegende Holländer, oder wie der Graf von Monte Christo, und daran seien meine Bilder schuld. Ich drückte der liebenswürdigen Frau natürlich mein Bedauern über die Enttäuschung, die ich ihr bereitet, aus und fügte hinzu, ich hoffe, die Erkenntnis, daß ich nicht der sei, für den sie mich gehalten, werde ihr nicht die Freude an meinen oder vielmehr an ihren Bildern verderben. Sie beruhigte mich und sagte, sie habe die Enttäuschung schon überwunden, ich gefiele ihr auch so ganz gut. Ähnliches ist mir übrigens oft gesagt worden, obgleich meine Bilder ohne jeden Anklang von Mystizismus und Romantik sind. Was mich bewegte, war stets Positives: „Die Sonne, die Schönheit, die Heiterkeit des Südens.“! – „Jawohl,“ sagte ich, „trotzalledem singt Camphausen vom Hexenmeister, den man sollt’ verbrennen.“*) Schließlich wurde ich dann aggressiv und behauptete, er sei wohl gar nicht so blond gewesen, wie er immer glaube, ich hätte ihn nur als braun in der Erinnerung. Höchstens zur Zeit, da er als kleiner Bub, als Amor auf der Lumpaci-Vagabundus-Leiter der Fortuna gestanden, könne er wohl blonde Locken gehabt haben. Kinder seien immer blond, und ein Mystiker und Romantiker sei er auch; ich erinnere ihn nur an die Nymphe Egeria, deren geheimnisvolle Grotte er so gerne gemalt, und an ihre Namensschwester in Böhmen, an das Mondscheinbild des versteinerten Brautzuges.
*) Noch steh’ ich mit den Meinen schier geblendet
Von allem Sonnenglanz, den du gespendet,
Und wüßte nicht mein Lied wie einst zu singen,
Daß Himmelsboten dir die Farben bringen,
Ich dächt’, es ging nicht zu mit rechten Dingen,
Den Hexenmeister würd’ ich draus erkennen,
Den man im eignen Feuer sollt’ verbrennen.
W. Camphausen.
Begannen wir zu streiten, was gewöhnlich nach dem Abendessen beim Glase Wein und seiner Zigarre geschah, dann lehnte sich meine Mutter behaglich in ihrem Sessel zurück. Nichts war ihr lieber, als wenn wir disputierten, dann brauchte sie nicht vorzulesen.
Als ich dem Grafen von Rosen, der wohl der größte Verehrer meines Vaters ist, die ersten Anfänge meiner Erinnerungen schickte und die Befürchtung aussprach, daß meine intimen Aufzeichnungen weitere Kreise kaum interessieren dürften, antwortete er mir: „C’est une chose du plus puissant intérêt, lorsqu’on a appris à connaître et à admirer un grand artiste en son œuvre, que d’entrer aussi dans son intimité par les relations de ses proches et de ses amis, d’apprendre aussi à connaître également sa personnalité morale et d’acquérir la preuve ques on caractère était à la hauteur de son génie. Il y a là une satisfaction de l’esprit, qui s’étend jusqu’au cœur.“ –
Auf Reisen
Es war ein Genuß, mit meinem Vater zu reisen. Seine Leistungsfähigkeit stellte zwar selbst in späteren Jahren noch starke Ansprüche an seine Umgebung; aber seine scharfe Beobachtungsgabe, sein schnelles Erfassen jeder Situation, sein nie versagender Humor und sein Geschick, die andern von dem reichen Schatze seiner Erfahrungen profitieren zu lassen, ohne je lehrreich oder ermüdend zu werden, machten ihn zum geborenen Cicerone und Reisemarschall. Er sah ja auch mit seinen Künstleraugen manches, was uns entging; seine größte Freude war es, uns darauf aufmerksam zu machen. Nichts sollte verloren gehen. Manchmal hatten wir aber von seiner Begeisterung zu leiden, wenn er uns auf der Reise, wenn es beinah’ Nacht war, weckte, weil er uns etwas Herrliches zeigen mußte. Eine leicht rosa getönte Riesenwolke, die den ganzen See und den ganzen Urirotstock bis in halber Höhe bedeckte, brachte uns einmal in Brunnen um den Morgenschlaf, und wenn Mutter dann brummte, meinte Oswald entschuldigend, es wäre doch eine Sünde und Schande gewesen, wenn er uns diesen Genuß vorenthalten hätte. In Desenzano klopfte er einmal in aller Frühe an meine Tür und behauptete, das Frühstück schon bestellt zu haben, denn es sei viel zu schön, um zu schlafen. Ich folgte ihm auch bald durch den kleinen Salon auf die in den See hinaus gebaute, ganz mit blühendem Oleander bestellte Terrasse, wo der Kellner wirklich schon den Frühstückstisch richtete. Da sah man, wie durch einen Blumenrahmen, den silberschillernden See und die fernen Berge im Morgenduft. Oswald behauptete später, ich habe gesagt, es sei so schön wie eine Theaterdekoration. Gesagt habe ich das sicher nicht, aber hören mußte ich es doch. Der Rückschlag der Begeisterung bestand in einem soliden Schnupfen, den wir uns alle drei bei diesem halbnächtlichen Frühstück geholt, denn es war schon herbstlich und empfindlich kühl. Auf dieser Reise hatte Oswald nun mit nächtlichem Wecken kein Glück mehr, wir hatten an einem Schnupfen genug.
Eine Situation zu verfeinern, einen Genuß auszukosten, das lag ihm im Blute, trotzdem hing seine gute Laune nicht vom materiellen Genießen oder Entbehren ab. Sie war unverwüstlich und riß uns mit. So saßen wir bei schwarzem Brot und Käse, in der rauchigsten Bierstube, genau so vergnügt beisammen wie an den kleinen Marmortischen des eleganten Café Florian in Venedig.
Fürst Leopold von Hohenzollern erzählte mir einmal bei einem Atelierbesuche, wie heiter er seinerzeit als Erbprinz mit der Erbprinzeß und meinen Eltern im „Elefanten“ in Brixen zu Abend gespeist habe. In der Wirtsstube an dem sauber gescheuerten Tisch hatten sie gesessen und Knödel gegessen. Er rief meinen Vater zum Zeugen auf, wie reizend und gemütlich es gewesen sei. Mein Vater hatte mir von dem Abend oft gesprochen. Während nämlich der damalige Erbprinz sich in seiner liebenswürdigen Art mit meiner Mutter und meiner ältesten Schwester unterhielt, hatten sich die Erbprinzeß und mein Vater auf das Kunstgebiet begeben. Die Erbprinzeß malte selbst sehr hübsch und hatte stets besondere Sympathien für Oswald. Dieser kam natürlich bald auf sein nimmer schweigendes Leid, das „Ausführensollen“ der Bilder, zu sprechen: gerade die Bilder, die nun zu Hause aufwarteten, seien im unmöglich auszumalen. Das habe er ihr erzählt, er graule sich, nach Hause zu kommen, und ganz besonders vor seinem sonst so geliebten Atelier. Da habe die Erbprinzeß ihn gefragt: „Aber, Herr Professor, warum „skizzieren“ Sie die Bilder denn nicht fertig?“ – Das sei ihm wie eine Offenbarung gewesen. Den anderen Tag schon habe er Sehnsucht nach Düsseldorf und nach seinem Atelier gehabt, und seit jenem Tage habe er alle seine Bilder „fertig skizziert“. Wie oft hat mein Vater mir die Geschichte erzählt, und wieviel öfter hat er gesagt: „Ich skizziere es fertig!“
Trotz Knödel und rußiger Bierstuben hieß es bei uns gar oft wie beim Großvater seligen Angedenkens:
„Was die Reis’ gekostet – – “
Indessen hätte kleinliches Rechnen meinem Vater die ganze Freude verdorben.
Schon frühzeitig versuchte er, auch bei uns Kindern das Verständnis für den „schönen Superlativ“ (wie er das nannte) zu wecken, sowie die Freude an der Natur, deren Effekte er durch allerlei Künste mit großem Geschick zu steigern wußte. So arrangierte er für uns fackelbeleuchtete Nächte auf dem Rhein, Jagdpartien auf dem Niederwald und an der Morgenbach, Gondelfahrten im mit Teppichen geschmückten Kahn. Eine solche Gondelfahrt von Aßmannshausen nach Lorch blieb uns allen durch ihr tragikomisches Ende unvergessen. Mein Vater hatte selbst den Kahn mit Teppichen, Blumen und Lampions dekoriert, und wir fuhren strahlend und von den Passagieren der vorüberfahrenden Dampfer begrüßt und bewundert den Rhein hinunter. Mein Vater sagte später manchmal: „Ich fürchte, wir hatten die Lorelei gesungen.“ Nun, die Wellen hatten uns nicht mit Schiffer und Kahn verschlungen, aber es hätte nicht viel daran gefehlt, und wir wären wirklich ertrunken samt Blumen, Lampions und Teppichen. Oswald sagte aber später oft mit einem Schelmenlächeln: „Seit dem Schrecken habe ich Rheinbilder verschworen; ade Mäuseturm und Lorelei. Höchstens ab und zu mal ein Nachtstück mit einem glutäugigen, gleich einem Ungeheuer aus dem Tunnel heranbrausenden D-Zuge habe ich gemalt. Erst viele Jahre später wagte ich mich an das Kloster Heisterbach; als ich aber den Drachenfels malen wollte, rächte sich die Lorelei. Ich nehme an, daß sie es war, denn mehr Kopfzerbrechen als dies Bild hat mir wohl keines gemacht. Ruhe hatte ich erst, nachdem ich es einfach übermalt hatte.“
Einen plausiblen Grund hatte er ja immer, wenn er ein Bild übermalen wollte. Meine Mutter aber verschwor seit diesem Abenteuer jede Kahnfahrt, und als sich ein paar Jahre später bei Sorrent ein unangenehmer Zwischenfall auf einem Mittelmeerdampfer ereignete und die Passagiere von „höchster Höhe“ in einen Kahn „geworfen“ wurden, wie sie gerne erzählte, ging sie auch auf kein Dampfschiff mehr. Die Sache ereignete sich im Jahre 1871. Mein Eltern waren damals vom Frühling bis Weihnachten in Rom und Neapel. Die Haupterinnerungen dieser Reise waren außer dem Schiffbruch bei Sorrent die Audienz bei Pio Nono, der speiende Vesuv und der Raub bei Kloster Camaldoli. Bei letzterem Abenteuer hatte der Eseltreiber, der wie üblich seinen kleinen Buben nebenher laufen ließ, meiner Mutter, die stets die Kasse führte, beim Aufstieg zum Kloster Camaldoli bei Neapel das Portemonnaie gestohlen. Oswalds größter Kummer war natürlich, daß er nun kein Cadeau für den geliebten Pater hatte. Der Treiber konnte selbstverständlich mit treuherzigster Miene seine Taschen umdrehen, denn sein Bub war längst mit der Beute in Nazareth.
Unser Freund Hermann Krüger erzählte bei jeder Gelegenheit: „Es reist’ sich mit niemanden so gut wie mit Achenbachs, sie haben immer einen Platz im Wagen frei, Oswald hat seinen göttlichen Humor, der sich nicht einmal verleugnet, wenn seiner Frau das Portemonnaie gestohlen wird, vorausgesetzt, daß er seinen Obolus für den frommen Bruder in der Tasche hat.“
Der rauchende und speiende Vesuv hat stets eine besondere Anziehungskraft auf Oswald ausgeübt. Im Jahre 1882 blieb man trotz der größten Hitze wochenlang in Neapel. Vom Salon des Hotels, wo soupiert wurde, ging’s auch immer schnell einmal auf die ins Meer hinausgebaute Terrasse, um festzustellen, ob der „alte Herr“ auch seine Schuldigkeit tue. Dies Kontrollieren behielt Abend für Abend denselben Reiz, bis mein Vater durchsetzte, daß draußen gespeist wurde.
Oswalds Skizzenbücher enthalten gar manchen Vesuv, denn der veränderte ja nach jeder Eruption seine Form. Auch viel neapolitanische Staffage, große Kriegsschiffe und kleine Barken, Masten und Segel, Netzflicker und nackte Buben, sowie faulenzende oder schlafende Lazzaroni, Makkaroniverkäufer, Maronen- und Fischröster sind darin die Menge. „Ganz glücklich waren wir aber erst, wenn wir wieder in Rom waren,“ pflegte meine Mutter zu sagen. Für sie hatte Rom noch einen besonderen Vorzug: das Fehlen von Barken, Gondeln und Dampfschiffen, und selbst die bösen Gewitter schienen in der heiligen Stadt an Schrecken zu verlieren. Meiner Mutter Angst vor dem Wasser erwies sich bei unserem oft längeren Aufenthalt an den oberitalienischen Seen als sehr hinderlich, denn nun mußten wir immer um die Seen herumfahren, worüber man uns natürlich oft auslachte. Aber im offenen Wagen mit vier Pferden und adrettem Postillon war die Sache gar nicht übel. Meine Mutter liebte die Fahrt im offenen Landauer über alles. Mein Vater und ich stiegen aber jeden Augenblick aus, um etwas zu marschieren, eine Höhe zu erklettern, oder wenn er eine Farbskizze machen wollte. Die schöne Natur regte ihn so sehr an, daß er es nicht lassen konnte, sofort an Ort und Stelle zu malen, oder wenn es nicht ging, doch zu zeichnen. Zeichnend stand er im Wagen, zeichnend in den Straßen: ich mußte seinen Stock, oft die Zigarre halten; die sollte dann auch nicht ausgehen. „Blas doch mal dran,“ animierte er mich wohl, wenn die Gefahr des Ausgehens groß war. Einmal, als ich gerade blies, kam ein Herr vorbei und lachte. „Der hat mich ausgelacht,“ sagte ich ärgerlich. „Ach was,“ sagte mein Vater, „der hat dich angelacht, ich hab’s gesehen.“ – Wenn mein Vater und ich auf Beute zogen, ausgerüstet mit Malkasten und Leinwand, da mußte meine arme Mutter oft stundenlang im Wagen sitzen und auf uns warten, bis wir, vorsichtig jeder an einer Ecke ein dickbemaltes Papier haltend, ankamen. Dann hatte meine Mutter allerdings die größte Freude, und das langweilige Warten war verschmerzt. Das Zeichnen aber erledigte er, wie schon erwähnt, stets in größter Geschwindigkeit, und diese flüchtigen Striche genügten ihm für sein späteres Bild. Es war wirklich, als wenn er, wie Paul Meyerheim in seinem Menzelbuch erzählt, einen photographischen Apparat im Kopf gehabt hätte.
Wenn meine Mutter sich dann im Hotel etwas hinlegen mußte, um abends wieder frisch zu sein, begaben Oswald und ich uns unter der Firma, noch etwas zu bummeln, in die feinsten Cafés, und gab’s so was nicht, dann tat’s auch das kleinste Bahnhofsrestaurant, später beichteten wir dann mehr oder weniger reumütig. –
Machten wir größere Fußtouren, so sangen wir wohl:
„Das Wandern ist des Müllers Lust,
Das Wandern.“ –
Dies hatte mein Großvater den kleinen Oswald pfeifen gelehrt, wenn bei den anstrengenden Fußtouren die kleinen Beine mit den großen nicht mehr Schritt halten wollten; ich aber konnte das Pfeifen nicht lernen, soviel Mühe sich mein Vater auch gab. Schließlich meinte er, singen ginge auch, die Soldaten sängen ja auch bei ihren Märschen, wenn es hieße „Rührt euch“. Aber Pfeifen sei gesünder, denn man schlucke weniger Staub. – Manchmal liefen wir meiner Mutter zu viel. Besonders, wenn es regnete und sich die Wolken türmten, da hätte sie uns am liebsten nicht aus dem Hotel gelassen, sie komplottierte wohl mit dem Arzt; aber wir komplottierten gegen, und ich schürte den Geist der Rebellion. Wenn wir so durch den Regen liefen, sah uns mancher Italiener nach. Die Italiener sind ja so wasserscheu! In Verona sahen wir einen Tagelöhner, der gegen einen leichten Regen – mein Vater und ich liefen ohne Schirm und Mantel herum – sich durch einen Korb, über den er einen leinenen Sack gezogen hatte und als Hut benutzte, außerdem noch durch einen großen blaugrauen Schirm schützte. Jedes Gewitter nennen sie einen Wolkenbruch. – Alles rennet, rettet, flüchtet! Eines Tages mußten aber auch wir daran glauben. Es war in Mailand. Oswald und ich waren in ein elegantes Café eingekehrt und taten uns gütlich. Da auf einmal gab’s Blitz und Schlag zugleich! Ein furchtbares Gewitter tobte los, wir hinaus! Aber so viel Droschken auch an uns vorbei rasselten, alle waren besetzt. Atemlos und naß wie die Katzen kamen wir im Hotel an und fanden meine Mutter halb tot vor Angst und in Tränen.
Diese schreckliche Nervosität verleidete ihr und uns oft das Leben, und so standen auch unsere Reisen im Zeichen der Gewitterangst! Aber Oswalds unverwüstliche gute Laune half auch hierüber weg, was freilich gut war; denn gewitterte es, dann war meine Mutter unberechenbar. In Ostende lief sie einmal bei einem Donnerschlag von der Straße weg in ein fremdes Haus und von dort in den Keller. Am Gardasee, bei den Resten von Catulls Landhaus, auf der Halbinsel Sermione war sie, obgleich die Pferde am Landauer wie die Lämmer standen, in eine abscheuliche feuchte Felsengrotte gedrungen, wo da allerlei zu krabbeln schien, was sie sonst durchaus nicht liebte. Die größere Nervosität gegen Gondel, Dampfschiff und Gewitter hing natürlich mit dem körperlichen Befinden zusammen. Im Herbste 85 war meine Mutter, von Marienbad kommend, so wohl und zufrieden mit sich, ihrer guten Kur und dem liebenswürdigen Geheimrat Ott, daß sie bei einem Gewitter mit uns zusammen im Hotelsalon blieb, ohne vorher den Versuch gemacht zu haben, in den Keller zu entfliehen. Dies Wunder geschah in Arona, und es war ein ganz schreckliches Gewitter! Der Lago Maggiore bäumte sich förmlich, die Schiffe, die zur Abfahrt im Hafen lagen, konnten nicht fort, die Maste klapperten unheimlich, denn die Schiffe wurden hin und her geworfen. Wolken, anscheinend dunkelbraun und grünlich, jagten über den Mond her, die Blitze beleuchteten zauberhaft den ganzen See und die fernen Berge. Ich stand mit meinem Vater auf der Veranda, bis der wolkenbruchartige Regen uns hineintrieb. Erst spät in der Nacht trennten wir uns, nach das Gewitter sich gelegt, der Sturm aber um so toller tobte.
Am andern Morgen fuhren wir im offenen Wagen nach Stresa, wir wollten zur Isola Bella. Das war nun wirklich eine herrliche Fahrt. Mein Mutter saß in behaglichster Stimmung in ihrem geliebten Landauer, die Luft war kühl, der goldene Staub, den Oswald so sehr zu malen liebte, aber bei den Wagenfahrten ebenso scheute wie wir, war verschwunden. „Dankbare Gefühle nach dem Gewitter,“ sagte er vergnügt und frei aus der „Pastorale“ zitierend. Als wir an der Anhöhe kamen, auf der die Riesenstatue des heiligen Carolus Borromäus steht, wollten wir trotz des lebhaftesten Protestes meiner Mutter natürlich hinauf. „Den will ich doch malen,“ sagte mein Vater, und schon war er aus dem Wagen und ließ sich vom Kutscher den Malkasten reichen. Meine Mutter behauptete zwar, wir würden im Schlamm stecken bleiben, und der Carolus wolle gar nicht gemalt sein, er drohe sogar mit dem Finger. „Ich male ihn aber doch!“ sagte Oswald, und sehr bald hatten wir des Carolus Borromäus wohlgetroffenes Konterfei in unseren Händen. Aber er hatte doch nicht umsonst gedroht, die Borromäischen Nachkommen rächten sich, wie wir zu unserm Schaden erfuhren. Denn als mein Vater und ich, die nach Tisch nach der Isola Bella gefahren waren, zu meiner Mutter in den Garten des Hotels Des Iles Borromées zurückkehrten, waren wir zwar entzückt von allem Schönen, das wir gesehen, und beladen mit herrlichen Blumen, die uns der freundliche Gärtner geschenkt, aber ohne sonstige Ausbeute! Jeder Strich zu zeichnen oder zu skizzieren war dort verboten. Der Besitzer, Graf Borromäus, hatte alle Rechte an eine photographische Gesellschaft in Frankfurt abgetreten. Es war zu schade! Denn der Eindruck, den wir empfingen, als wir durch die reich dekorierten und eleganten Säle, au die schöne, von Balustern umgebene Terrasse hinaustraten, war großartig und überraschend in der Gesamtwirkung. Mein Vater zeichnete im Hotelgarten die Terrasse aus der Erinnerung in sein Skizzenbuch: er machte dann vor unserer Abfahrt noch eine Farbstudie von der Isola Bella, wie man sie von dem Garten des Hotels aus liegen sieht.
Im Herbst 95 verfolgten uns die Gewitter, doch haben wir an einen Spätnachmittag in Ragaz, wo wir mit Herrn Fridolin Simon zwischen den Fässern saßen und Chablis tranken, immer gern zurückgedacht; damals machte Oswald noch in Chablisstimmung eine entzückende Farbstudie vom Falkniß, der in rotglühender Pracht vor uns lag.
Ein großer Vorzug unserer Reisen für mich war, daß Oswald mir gelegentlich die amüsantesten Sachen erzählte. Er wußte, wie sehr ich das liebte, und weil er sich mir für heimlich entfernte Farbflecke sowie für das Ordnen seines Malkoffers verpflichtet fühlte, revanchierte er sich auf diese Weise. Auch von seiner Malerei erzählte er mir dann. Ein strahlend klarer, aber sehr heißer Septembermorgen im Garten der Villa Negro bei Genua ist mir unvergeßlich. Wir hatten uns am schönsten Aussichtspunkt im Angesicht des Meeres behaglich installiert und sahen den Schiffchen zu, die im glitzernden Sonnenschein tanzten. Mein Vater sagte: Dieses Tanzen der Schiffchen im Sonnenschein hat mir stets so gut gefallen, und ich habe immer und immer wieder versucht, dieses annähernd auf meinen Bildern wiederzugeben. Einmal war es mir auf einem Golfbilde wirklich gelungen, denn ich sah in meiner Phantasie die Schiffchen buchstäblich in der Sonne tanzen, ich war so stolz, daß ich den anwesenden Raseur mit ins Atelier nahm, um ihm das Bild zu zeigen. Mit vergnügtem Schmunzeln auf die Schiffchen deutend, meinte er: „Gelt, Herr Professor, dat sind Entches?“*) Ikarus konnte nicht zerschmetterter sein wie ich; schließlich tröstete ich mich damit, daß auch unsere stolzesten Leistungen immer noch an die Phantasie des Beschauers appellieren, und daß die Phantasie des besten Raseurs ihre gesteckten Grenzen hat.
*) Rheinischer Diminutiv für junge Enten.
Meine Eltern und auch wir jüngeren Kinder haben wohl den größten Teil unserer Reisezeit am Badeort zugebracht. Es knüpfen sich an unseren Aufenthalt in Karlsbad und Neuenahr, besonders aber an Wildungen, Marienbad und Kissingen so viele liebe und heitere Erinnerungen, daß es undankbar wäre, nicht gerne daran zurückzudenken.
Mein Vater schloß sich auf der Reise leichter an. Besonders am Badeort sammelte sich bald ein Kreis gleichgesinnter Seelen um ihn. Da wurden feste Freundschaften geschlossen, wie seinerzeit auf dem Rigi mit dem damaligen Bundesgesandten in Konstantinopel, Baron Prokesch-Osten; in Kissingen mit dem Münchener Maler Guido von Maffei und seiner reizenden Frau, den Familien Wendt aus Bremen, Konsul Otto Heye aus Düsseldorf, Grommé aus St. Petersburg und manchen anderen. Besonders große Freude war es stets, unverhofft alte Freunde zu treffen. Ich erinnere mich noch mit Vergnügen, wie in Wildungen unter Donner und Blitz, enggedrängt unter dem schmalen Dache des Kurbrunnens, einige mit einem ebenfalls bedrängten Nachbar ausgetauschte Worte ein solches Wiedersehen herbeiführten. Der Betreffende war Graf August Pourtalès aus Genf, ein Schüler aus den sechziger Jahren. Das war eine Freude, ein Fragen und Schwatzen; wir waren dann täglich zusammen. Graf Pourtalès erzählte mir begeistert, wie die Schüler meinen Vater geliebt und verehrt hätten, und hin und her flogen die Erinnerungen aus alter Zeit.
Aber Reisebekanntschaften machten wir eigentlich nur am Badeort; im Jahre 1885 waren wir z. B. drei Wochen an den oberitalienischen Seen und sprachen nur zwei Menschen. Merkwürdigerweise waren es beide Oberbürgermeister, der Sindaco von Venedig, Graf Alighieri und der Sindaco von Padua, dessen Name ich leider vergessen habe. Wir trafen den ersteren im Zuge Mailand-Venedig. Der Graf war ein schöner Mann, trug einen ganz weißen Anzug und hatte eine Maréchal Niel-Rose im Knopfloch. Er war auch sehr liebenswürdig und bot uns seine Gondel an, die meiner Mutter aber mit Entsetzen ablehnte; sie zog es vor, mit meinem Vater den Weg zum Hotel „den roten Stein lang“ zu Fuß zu pilgern, nachdem sie mich und die Kammerfrau in eine Mietgondel verladen hatten. Einige Tage später trafen wir auf dem Wege von Venedig nach Padua den andern Sindaco. Er war nicht so schön wie der Graf Alighieri, aber sehr lustig. Wir haben noch oft seiner gedacht, denn die italienischen Lieder, die er uns empfahl, wurden Oswalds Lieblingslieder. Mein Vater war in seiner Gesellschaft in eine so heitere Stimmung geraten, daß er, als uns der Wirt im Hotel die Zimmer undeci, dodeci, tredeci als die unsrigen nannte, ganz laut aus Boccaccio zu singen anfang: „Immer nur undeci, dodeci, tredeci tralala la-la-la“ und sich höchlich amüsierte, als aus zwei benachbarten Türen zwei benachtmützte und empörte „Missen“ herausschauten.
Der siebzigste Geburtstag I
Der Lebensabend
Der siebzigste Geburtstag
Mein Vater hatte gar keine Lust, siebzig Jahre alt zu werden, und meinte verschiedentlich, ob man den Tag nicht etwas hinausschieben könne, er fühle sich noch gar nicht würdig, alle die Auszeichnungen, von denen gemunkelt wurde, über sich ergehen zu lassen. Meine Mutter, die Freunde und wir Kinder freuten uns aber über alles, was wir hörten; wir fanden es sehr richtig, daß Oswald dem „Gefeiertwerden“ ein Greuel war, nun auch einmal stillhalten sollte. Meine Mutter freute sich besonders, als man ihr erzählte, daß er Ehrenbürger der Stadt Düsseldorf werden solle. Freunde von nah und fern hatten sich schon seit langem angesagt. Ein Festkomitee entstand, aber die Feste konnten nicht gefeiert werden. Mein Vater erlitt den größten Schmerz seines Lebens am 18. Dezember 1896; kaum sechs Wochen vor seinem 70. Geburtstage verlor er seine treue Gefährtin, wir unsere gute Mutter. Sie war nach kurzem Krankenlager sanft entschlafen.
Meine Vaters Verzweiflung war groß, er hatte nicht an die Möglichkeit gedacht, sie verlieren zu können. Das war nun ein trauriger Geburtstag. Die Blumen, die kamen, wollte er nicht sehen, die Telegramme nicht lesen, alles erinnerte ihn zu sehr an die noch so nahen Tage, wo auch Blumen und Telegramme das Haus überschwemmten und meine Mutter zur ewigen Ruhe getragen wurde. Stille Wochen und Monate folgten, mein Vater, der auch körperlich gebrochen war, erholte sich nur sehr langsam, und wir mußten fürchten, daß nicht nur der Schmerz und die Trauer, sondern auch eine innere Krankheit seinen Zustand verschuldeten. Doch als der Herbst herankam, fühlte er sich anscheinend viel wohler, und so beschlossen wir, eine Reise nach Oberitalien anzutreten, und zwar über den Kaiserstuhl ins Berner Oberland und von dort nach Florenz. Anfang September 1897 traten wir unsere Reise an. Wir fuhren zuerst nach Lilienhof auf den Kaiserstuhl, und mein Vater genoß noch recht aus dem Vollen das heitere Zusammensein mit seiner Lieblingsnichte, der Tochter seines Vetters Hermann Achenbach aus Moskau. Aber schon in Interlaken, wo wir mit lieben Freunden und Verwandten schöne Tage verlebten, zeigte es sich, daß er sich körperlich nicht wohl befand. Ich fühlte, daß wir Florenz aufgeben mußten. Mein Vater war außer sich, als ich ihm meine Befürchtung nicht mehr vorenthalten konnte; schließlich gab er mir aber doch recht und wurde ganz vergnügt, als ich ihm vorschlug, unseren ganzen Reiseurlaub „einfach in München“ zu verbringen. Mit der schönen Isarstadt hat man ihn nie vergeblich gelockt. Alle Erinnerungen seiner ersten Jugendzeit waren mit ihr verknüpft; seinen einzigen Sohn hatte er sogar nach dem Schutzpatron von München Benno genannt. Wir fuhren also nach München; und es war unser Glück, denn mein Vater erkrankte gleich nach unserer Ankunft, und wir fanden nun hier die vorzüglichen und hervorragenden Ärzte: Professor von Angerer und Dr. May, ein Schwiegersohn von Hermann Kaulbach, durch deren Umsicht mein Vater bald wiederhergestellt wurde, und die Mittel und Wege angaben, ihn in kürzester Zeit von seinem vorhandenen Leiden endgültig zu befreien. Das geschah auch im Herbst des nächsten Jahres durch eine Operation, die Geheimrat Marc in Wildungen ausführte. Nach dieser Operation wurde er wieder ganz gesund.
Der Lebensabend
Oswald war stets ein Problem für die Ärzte. Nach einer Übermüdung manchmal stundenlang ganz schwach, war er nach kurzer Zeit so frisch und rüstig, daß mitleidige Freunde, die ihm einen Krankenbesuch machen wollten, ganz perplex waren, das Nest leer zu finden. Der Patient saß wohl und munter im Theater oder hatte sonst etwas unternommen. Merkwürdig war, daß er nach solchen Schwächeanfällen, die gastrischer Natur waren, abends stets besonders aufgeräumt war und einen wundervollen Humor und großartigen Appetit entwickelte.
In den letzten Jahren waren wir alle stets viel bei meinem Vater im Atelier. Da die gute Mutter nun fehlte, war er ja der Mittelpunkt. Wie in früheren Zeiten schleppte Johann die großen Untermalungen hinauf und hinunter. Unser aller Lieblingsbild aber war und blieb das Papstbild „Pio nono“ in den vatikanischen Gärten, eine Audienz erteilend. General von Loë, dem persönlich Leo XIII. besonders nahestand, lag meinem Vater damit in den Ohren, „Pio nono“ in Leo XIII., den politischen Papst, zu verwandeln. Aber der sagte, dann müsse er auch die rote Kuppel der Peterskirche übermalen, die unter Leo XIII. blaugrau gedeckt worden sei. So saßen sie und Pater Paulus von Loë oft stundenlang vor dem Papstbilde, und das für und gegen Pius und Leo wurde durchgesprochen. Oswald ließ sich jedoch seinen geliebten Pio nono nicht abdisputieren und setzte den schönsten Argumenten einen zwar passiven, aber erfolgreichen Widerstand entgegen. Sobald es sich ums Malen handelte, machte er überhaupt keine Konzessionen.
Einmal fragte ihn eine schöne Frau, ob es nicht ein stark entwickelter Oppositionsgeist sei, der ihn, wie er gerade erzählt hatte, hindere, sich beim Malen den Wünschen anderer anzupassen? Er sei ein Krakeeler, und wolle man Schatten, so male er glühende Sonne, und umgekehrt. – – „Da irren Sie aber sehr,“ antwortete er, „das Bild, das ich male, habe ich malen müssen! Es steckt in meiner Phantasie und bereitet mir richtige Schmerzen, bis ich wenigstens die erste Untermalung leibhaftig vor mir habe, erst dann fühle ich mich beruhigter.“
In den letzten Lebensjahren war außer dem Malen und dem lebhaften Verkehr mit seinen Freunden, der Besuch des Theaters sein Hauptgenuß, sein Interesse, seine Erholung. Er bevorzugte die Oper, er verehrte Wagner aber Beethoven und Mozart, Weber, Mendelssohn und auch Verdi standen ihm näher. Absolut begeisterte ihn Puccinis Tosca, – wir sahen sie, so oft sie gegeben wurde; – auch Mascagni, Leoncavallo und Bizet sah er gerne, von Offenbach am liebsten den Orpheus und Hoffmanns Erzählungen. Freund Loë sagte dann wohl zu mir: „Papa denkt mit Zola: Mieux vaut crever de passion que d’ennui.“ Der General war zwar auch nicht für Langeweile, doch wurden er und mein Vater, was Lebenslust und Frische anbelangt, von unserem verehrten Freunde Exzellenz von Liliencron, dem berühmten Germanisten, noch bei weitem übertroffen.
Im Frühjahr 1900 wurde mein Vater um seine Unterschrift zu dem Protest gegen die Lex Heinze gebeten.
General von Loë, welcher sich auf der Rückreise aus Italien in Baden-Baden zur Kur befand, schrieb mir bei dieser Gelegenheit:
„… Vor allem freut es mich, daß es Ihrem Vater gut geht. Ich hatte diesen Eindruck schon durch die Zeitungsnotiz, daß er sich an dem Proteste der vernünftigen Leute gegen die Lex Heinze beteiligt hat. – Ich kann Ihnen sagen, daß streng religiös gesinnte Leute dieses Zielüberschießen ebenfalls bedauern. Ich zweifle nicht, daß ein vernünftiges Gesetz zustandekommt, welches dem Unfug zu steuern geeignet ist und die Maßregelung auf den eigentlichen Zweck beschränkt.“ –
Diese Auffassungen teilte die ganze Donnerstag-Tafelrunde, trotzdem sie aus den verschiedensten Elementen zusammengesetzt war. Das erregte denn auch Verwunderung, und verschiedentlich sprach man meinen Vater und mich auf der Straße an und meinte: „Das mag bei Ihnen Donnerstags ja ein schönes Schlachtfeld sein, wenn der fromme Salentin, die leichtlebigen jungen Künstler und Sie, der Sie den Protest gegen die Lex Heinze mitunterschrieben haben, aneinandergeraten.“
Aber die Donnerstag-Tafelrunde, die Alten, die Jungen, die Frommen, die Weltlichen waren wie gewöhnlich einig und friedlich, jeder respektierte des andern Meinung.
Als nun im Jahre 1902 der Kölner Erzbischof Dr. Simar gestorben war, konnte der General, der so tapfer seine Ansicht über die Lex Heinze ausgesprochen hatte, in einigen Witzblättern lesen, daß er Chance habe, bei der Neubesetzung dieses erzbischöflichen Stuhles berücksichtigt zu werden. Der General versäumte nicht, die Donnerstag-Tafelrunde durch ein Telegramm von seiner Kandidatur geziemend in Kenntnis zu setzen.
Da aber Freund Loë dann nach Rom fuhr, erwachte auch in Oswald die Reiselust. Der General schrieb so amüsante Briefe und riet uns dringend, ihm baldmöglichst nach Rom zu folgen. In einem Briefe beschrieb er die Audienz südfranzösischer Pilger, der er beigewohnt. Die temperamentvollen Kinder der Pyrenäen hatten dem heiligen Vater in ihrer warmherzigen Art „Hundert Jahre“ alt zu werden gewünscht; Leo XIII. hatte sich aber lächelnd gewehrt und gemeint: „Mes chers enfants, nous ne voulons pas mettre des bornes à la providence.“
Ein andermal hieß es: „… Gestern und heute habe ich mit meinen beiden Begleitern, dem General Haußmann und dem Prinzen Salm, etwas hundert Visiten gemacht, darunter sechsunddreißig Kardinälen. Es wären siebenunddreißig gewesen, wenn der Siebenunddreißigste im Moment, als wir uns bei ihm melden ließen, nicht gerade gestorben wäre.“
„Freund Loë hat’s gut,“ sagte mein Vater ganz wehmütig, „warum gehen wir nicht auch endlich nach Rom?“
Aber trotz der Sehnsucht nach Italien amüsierte er sich auch in Düsseldorf ganz gut, besonders zur Zeit der großen Ausstellung 1902 und 1904.
Wenn einige mißvergnügte Nobili meinten, das sei das alte Düsseldorf nicht mehr, antwortete er wohl: „Ja, ja, ich weiß, – die gute alte Zeit! – – Da gab’s bei Schulte nur bilder von Düsseldorfer Künstlern, und Sonntags erschien der „Jägerhof“ und die Haute-volée, um sich den neuen Deger, Köhler, Carl oder Andreas Müller, Jordan, Itten – oder Achenbach anzusehn. Mann! seien Sie doch froh, daß die Zeiten vorbei sind. Ich für mein Teil habe mich in meinem ganzen Leben kaum so gut amüsiert wie gerade jetzt.“
So hatte er die letzten Jahre seines Lebens wirklich noch recht aus dem Vollen genossen. Obgleich er mir zugab, sich manchmal etwas matt zu fühlen, wollte er doch bei allem dabei sein. Als wir am 19. Januar Salentins 83. Geburtstag in der Oktave feierten, war er noch voll überschäumender Laune. Aber er litt an einer Erkältung, die nicht zum Ausbruch kommen wollte und sah schlecht aus. Es kostete viel Mühe, ihn zu bereden, die nächsten Tage ganz auf seiner Etage zu bleiben. Eine neue Oper, von der viel gesprochen wurde, sollte aufgeführt werden, und in der Hoffnung, daß der Stubenarrest ihn bald auskurieren werde, ergab er sich in sein Schicksal.
So kam der 2. Februar heran, an welchem er sein 78. Jahr vollenden sollte. Am 31. Januar nahm der Schwächezustand bedeutend zu, wir waren sehr sorgenvoll, er aber heiter wie immer. Unserem Hausarzt Professor Hoffmann, der ihn bei seinem morgendlichen Besuche fragte: „Nun, Herr Professor, wie geht es Ihnen heute?“ antwortete er mit einem halben Lachen: „Wie es mir geht? Ja, lieber Freund, das hatte ich Sie eigentlich fragen wollen.“ Da wir in diesen Tagen mit ihm zusammen im Atelier gelebt hatten, waren zwei Staffeleien entfernt worden, nur die mittelste, auf der das Papstbild stand, blieb stehen. Mein Vater lag auf seiner Chaiselongue und besah sich sein Lieblingsbild. Am Nachmittag besuchte mich unser Freund, der Oberbürgermeister Marx, der mich schonend darauf vorbereiten wollte, daß Papas Zustand recht bedenklich sei.
Als mein Vater an diesem Abende dem Papstbilde „gute Nacht“ sagte, war es ein Lebewohl für immer. Er schlief zwar in den ersten Stunden der Nacht ganz ruhig, später fieberte er, hatte aber keine Schmerzen, lächelte uns an und schlummerte weiter. Am frühen Morgen konstatierte der Arzt eine schwere Lungenentzündung, aber mein Vater lag ruhig und schlummerte, wie ich wohl fühlte, dem ewigen Schlaf entgegen. Und so blieb er schlummernd und lächelnd, wir sahen, daß er nicht litt.
Um drei Uhr stand das Herz still.
Trotz unseres Jammers erfüllte uns eine namenlose Dankbarkeit gegen Gott. Das war kein Tod, kein Sterben, das war ein Hinübergleiten in das andere Leben.
Schluß
Schluß
Wenn man meinem Vater, der bis zuletzt so frisch und lebenslustig war, sagte, er mache einen so „jugendlichen Eindruck“, so antwortete er oft: „Eigentlich müßte ich schon über 80 Jahre alt sein, denn ich bin zehn Jahre älter als andere Leute, da ich zehn Jahre früher als alle anderen angefangen habe zu leben und zu arbeiten; darum habe ich auch so viele Bilder gemalt.“
Und dann erzählte er, wie früh er angefangen habe zu lernen, und besonders, wie fleißig er gewesen sei, daß er schon mit 24 Jahren eine Familie gegründet und sein ganzes Leben lang immer mit demselben Fleiß und derselben Freude wie in seiner Jugend gearbeitet habe. Er bedaure nur, daß er keine Ahnung habe, wie viele Bilder er eigentlich gemalt und wohin si gekommen seien, er habe nie ein Buch darüber geführt. Die meisten seiner Bilder seien von Rom und seiner Umgebung, dies wisse er ganz bestimmt, dann erst käme Neapel und sein Golf; er habe auch eine große Anzahl Schweizerbilder gemalt, und diese hätten ihm immer sehr viel Freude gemacht.
Graf Rosen schrieb mir über die Möglichkeit, noch jetzt einen Katalog sämtlicher Werke herzustellen: „– j’aurais une idée à vous soumettre: ne croyez-vous pas, qu’il serait, pour la majorité des lecteurs, d’un haut intérêt que vous ajoutiez à la fin du volume une nomenclature, aussi complète que possible, des œuvres de votre père, avec indication du propriétaire originaire? Outre la valeur historique d’un pareil document il offrirait l’avantage de contrôler, à l’avenir, de possibles falsifications. – Songez seulement combien profitable auraient été, sous ce rapport, de pareils catalogues dressés par les grands maîtres d’autrefois eux-mêmes et répandus ainsi à milliers d’exemplaires! – Qu’en pensez-vous?“
Ich glaube nicht, daß es so leicht sein dürfte, einen solchen Katalog herzustellen, schon aus dem Grunde, weil fast alle Bilder, die in den sechziger und siebziger Jahren entstanden sind, nach New York, Philadelphia, Washington und Chicago gingen. Ich habe aber durch meine Freunde in Erfahrung zu bringen gesucht, welches die bekanntesten und beliebtesten Bilder meines Vaters sind.
Eduard von Gebhardt gibt dem „Leichenbegängnis in Palestrina“ den Vorzug. Mein Vater hat das Bild zweimal gemalt. Das etwas kleinere befindet sich in der Kunsthalle in Düsseldorf. Das andere kaufte seinerzeit Napoleon III. von Ed. Schulte; soviel ich weiß, hat die Firma es nach dem Tode der Prinzessin Mathilde aus deren Nachlaß wieder erworben.
Geh. Rat Woerman (Dresden) legt einen besonderen Wert auf die Gemälde, die den Golf von Neapel wiedergeben. Ich zitiere etwas aus seinem Reisetagebuch (Neapel, 1878):
„Als wir auf der Rückfahrt die Höhe des Posilip wieder erreichten, war die Purpurglut des Abends bereits erblichen. Aber tief und leuchtend rosenrote Wolken zogen am Himmel und gossen noch einen leichten süßen Rosenschimmer auf die Straße, auf der wir fuhren. Das Meer war violett. Die Gebirge waren grau. Die Häuser der großen Stadt schimmerten schneeweiß herüber. Unter den malern kenne ich nur einen, der derartige gewagte Stimmungen fast so fein und geistreich zu verarbeiten weiß, sie die Natur selbst. Ich meine unsern Oswald Achenbach, den eigentlichen Maler des Golfs von Neapel. Er hat den göttlichen Golf im hellen, heißen Mittag und in nächtlichem Dunkel, im Purpurlichte der sinkenden Sonne und in so seltsam bunter Dämmerung gemalt, wie wir sie jetzt sahen. Nur er wird nicht bunt und süßlich wie die meisten, die sich solche Aufgabe stellen. Seine Bilder sehe ich hier immer wieder in die Landschaft hinein, und die Erinnerung an seine Gemälde lehrt mich diese Natur verstehen. –“
Selbst die jungen Künstler räumen Oswald gerne eine Ausnahmestellung ein. Sie verwahren sich energisch dagegen, daß man ihn in die Ecke stelle, wo schon mancher Kollege auf ihn wartet. So erzählte mir Baron Karl von Perfall, Köln, von seinem Sohne, einem sehr modernen Düsseldorfer Landschaftsmaler, der ihm, nachdem er von einem einjährigen Aufenthalt in Florenz zurückgekehrt war, gesagte hatte: „Ich habe in der italienischen Landschaft oft die Naturstimmungen gesehen, die Oswald Achenbach gemalt hat; die sind durchaus wahr, und ich weiß jetzt erst, was für ein großer Meister er war, denn Italien gibt den deutschen Malern schwere Rätsel auf, die er vollkommen gelöst hat.“
Auch Graf von Rosen sieht in Oswald Achenbach in erster Linie den Schilderer Italiens. Im Mai 1910 schrieb er mir aus Stockholm: „Laissez-moi ensuite vous répéter que votre travail de piété filiale m’intéresse infiniment, comme m’intéresse tout ce qui touche le caractère, le talent, les idées et les habitudes de chaque grand homme; et dans le domaine de l’art votre père m’apparaît comme une des figures les plus grandes et les plus originales qui fût jamais. Car lorsque j’associe son souvenir à celui de tous ldes maîtres du paysage qui ont aimé et dépeint l’Italie depuis Claude et Poussin jusqu’à Turner, Corot, Schirmer, Boecklin et d’autres encore, Oswald Achenbach se dresse au-dessus d’eux tous, par la puissance de son génie, qui a trouvé le secret jusqu’à lui ignoré, d’unir à une conception d’un sentiment hautement idéal une production d’un réalisme stupéfiant, nous offrant, ainsi dans des éblouissements de soleil et des enchantements de couleurs, la poésie même du pays italien, de son ciel radieux, de son sol enflammé, de ses rives bleuissantes, du clair obscur de ses jardins, de la splendeur de ses monuments, du grouillement de son populaire. Il me semble qu’après Oswald Achenbach, il y a,artistiquement parlé, plus rien de nouveau à faire de ce coin de terre dont dix générations de peintres se sont acharnées à chercher des interprétations diverses. Avec son œuvre le sujet est épuisé, la discussion est close – – –.“
Graf von Rosens Lieblingsbilder sind Rocca di Papa in der Galerie in Dresden, der Golf von Neapel im Museum in Leipzig und die Villa Borghese in der Kunsthalle zu Düsseldorf.
Mein Vater selbst erzählte mir, daß verschiedene Bilder, die nach seiner Ansicht zu seinen besten gehörten, in Wien seien; wenn er dann nachdachte, hieß es aber gewöhnlich: „in Hamburg und Bremen (dann kamen noch viele andere Städte) sind, glaube ich, auch ein paar ganz gute.“
Als ich Professor Oeder (Düsseldorf) um sein Urteil bat, antwortete er mir:
„Nun zu Ihrer Frage, welche Bilder Ihres Vaters in künstlerischer Beziehung als die höchststehenden mir in Erinnerung geblieben seien. Dies ist nicht allzu leicht zu beantworten, wenn ich auch wohl die meisten Arbeiten aus der reifsten Schaffenszeit gesehen habe. Es ist aber eine so gewaltige Anzahl wunderbarer Schöpfungen in die Welt hinausgegangen, daß hieraus nicht leicht die Wahl zu treffen ist.
Um aber in etwa Ihrem Wunsche nachzukommen, so will ich zweier Werke Erwähnung tun, die die Eigenart Ihres Vaters in eminenter Weise bekunden, und das ist in erster Reihe das wunderbar sonnige Bild der Villa Borghese in unserer hiesigen Galerie. Wie ist hier die Abendsonne wiedergegeben!
Diesem Bilde anzureihen wäre meines Erachtens „Der Lärchenwald mit der Prozession“, ein kleines Werk, jedenfalls sehr schnell entstanden, aber von einer Stimmung, die der Meister kaum in anderen Arbeiten übertroffen hat. Wie wirkt auch hier wieder die Sonne, die durch das frische Lärchengrün auf die Prozession und besonders auf den kleinen Tragaltar fällt!“
Unter den Schweizerbildern gehörten außer dem Lärchenwald wohl Wengen und die Jungfrau, der Blick auf den Rigi, der St. Bernhard und der Kirchhof von Beckenried zu den bekanntesten. Die Zeichnung zu dem St. Bernhard wurde einem Skizzenbuch aus dem Jahre 1843 entnommen. Das Hospiz liegt in Nacht und Schnee, hinten türmen sich die weißen Berge; im Vordergrunde die Brüder mit ihren Hunden und brennenden Laternen auf der Suche nach Verirrten. Dieses Bild fand so viel Anklang, daß mein Vater es verschiedentlich malen mußte, was ihm sehr unangenehm war; aber da es ihm schwer wurde, eine Bitte abzuschlagen, so hatte er sich dazu bequemt. Allerdings versüßte er sich diese Pille, indem er ein Hospiz mitsamt seinen Schneebergen im roten Reflex der untergegangenen Sonne malte.
Professor Walter Petersen, Düsseldorf, und Exzellenz von Boehn, Kommandant von Berlin, berichten über zwei deutsche Bilder, Drachenfels und Gravelotte, die beide das traurige Schicksal traf, übermalt zu werden. Ich lasse Walter Petersen erzählen:
„Einst bewunderte ich im Atelier Ihres Vaters eine Landschaft großen Formates vom Siebengebirge. Das Siebengebirge als Hauptsache, von der anderen Rheinseite aus gesehen, war fertig und wunderbar schön in der Gewitterstimmung mit dem Regenbogen. Aber der Vordergrund machte Ihrem Vater noch zu schaffen, er suchte nach einem neuen Problem der malerischen Lichtverteilung, durch die er im Vordergrund auf den malerischen Eindruck des Hintergrundes, also des Siebengebirges, wirken wollte. Als ich das Porträt Ihres Vaters für die Kunsthalle malte, stand das Bild auf einer Staffelei in seinem Atelier mit völlig verändertem Vordergrund, für die Augen des großen Meisters noch immer nicht gelöst. Schließlich erfuhr ich, daß er die Lösung, die ihn selbst befriedigte, nicht fand, und daß er darum das ganze schöne Bild vernichtet hat.“
General von Boehn, der in den achtziger Jahren in Begleitung des damaligen Prinzen Wilhelm, unseres jetzigen Kaisers, ins Atelier kam, schrieb mir (als er hörte, daß ich Erinnerungen sammle) über diesen Besuch. Damals malte mein Vater an einem Schlachtfelde von Gravelotte. Von Metz aus war er mit meiner Mutter und einem Freunde, dem Major Kardinal von Widdern, hinausgefahren, um die Schlachtfelder zu besichtigen. Ich lasse Exzellenz von Boehn erzählen:
„Den Besuch des Prinzen Wilhelm betreffend, will ich Ihnen folgendes noch erzählen: Nachdem Ihr Papa die Bilder gezeigt hatte, an denen er gerade arbeitete, bat ich ihn, doch auch ein Bild hervorzuholen, an dem ich ihn vor kurzem hatte malen sehen. Es war das Schlachtfeld von Gravelotte. Ich wußte, daß dies Sujet für den Prinzen ein besonderes Interesse hatte. Nun fand der Prinz an dem Bild nicht nur ein großes Gefallen, sondern geradezu ergreifend war die Schilderung Ihres Vaters, wie er dazu gekommen, dieses Bild zu malen. Er erzählte, daß er die Schlachtfelder von Metz besucht habe, und zwar am Tage Allerseelen. Da habe er tief bewegt auf dem Felde gehalten, auf dem vor Jahren so heiß gestritten und so viel Blut geflossen, auf dem die deutschen Waffen schließlich den Sieg errungen hatten. Und nun gleich das Feld einem unendlich großen, stillen Friedhof, weit und breit bedeckt mit Kreuzen und Grabsteinen, zur Erinnerung an die Tapfern, die hier für ihr Vaterland den Heldentod gestorben. Eine feierliche Ruhe herrschte ringsumher; friedlich weidete ein Hirt seine Schafe in der Ferne.
Da habe ihr Vater seiner Heimat gedacht, in der heute am Allerseelentag groß und klein zu den Gräbern pilgert, und hier war niemand gekommen, die Gräber zu schmücken, und es wurde schon Abend. Die untergehende Sonne grüßte mit ihren letzten Strahlen das weite Feld. So etwa hatte Ihr Papa erzählt, aber er schilderte dabei seine Empfindungen in so ergreifender Weise, daß wir mit immer steigender Wärme und Andacht uns in das Bild vertieften. Was mag aus dem Bilde geworden sein? Ich habe es nicht wieder gesehen.“
Als Exzellenz von Boehn erfuhr, daß das Schlachtfeld zu Gravelotte in einen Golf von Neapel verwandelt worden war, erzählte er mir noch, daß mein Vater dem Prinzen Wilhelm und ihm vorgeklagt habe, daß er solche Bilder wie Gravelotte eigentlich gar nicht malen dürfe, man wolle von ihm nur immer und immer wieder den Golf von Neapel.
Wie Oswald nun einmal war, ist es sehr möglich, daß gerade dieser Atelierbesuch ihn dazu begeisterte, das Schlachtfeld von Gravelotte in einen Golf von Neapel zu verwandeln. Ich weiß noch recht gut, wieviel Freude ihm dieses Übermalen gemacht hat. Denn wenn das Schaffen solcher Bilder für ihn auch eine poetische Erinnerung, eine geistige Anregung bedeutete, so lag der Hauptreiz im Bewußtsein, sie später übermalen zu können, und diese Entwürfe waren daher von Anfang an dem Verderben geweiht. Sie waren ihm ja der liebste Untergrund für seine Mondscheinbilder, und später breitete sich wirklich über das Schlachtfeld von Gravelotte ein Golf vonNeapel im Mondschein aus. Die Farbstudie zum Schlachtfeld war Kardinal von Widdern zugedacht, ob er sie aber erhalten hat, weiß ich nicht; vielleicht ist auch sie übermalt worden, denn ob Drachenfels, ob Gravelotte, eines schönen Tages lachte doch darüber der blaue Himmel Italiens, oder es spiegelte sich der silberne Mond im Mittelmeer.
„Es ist mein Verhängnis,“ entschuldigte er wohl lachend solche Widersprüche, „bin ich doch unter dem feuerspeienden Vesuv geboren.“
Das letzte Bild, das mein Vater vollendet und abgeliefert hat, war ein ganz großer Golf von Neapel.